Links
Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin
Zwischen Traum und Realität- Israels Raumfahrtprogramm
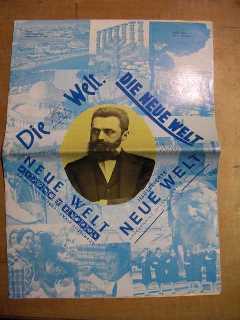
The Jewish Week

Wollen wir mit dem Quatsch nicht endlich aufhören?

Obama says Iraqi, Kurdish forces have reclaimed strategic Mosul Dam
Liebesgrüße aus Moskau

Tablet Magazine



The Jewish week

Der Islam hat zivilisatorisch vollkommen versagt

ÖBB: Ausstellung „Verdrängte Jahre“ in Klagenfurt
Bedeutung und Bestimmung der Bahn im Nationalsozialismus von 1938 bis 1945
Themenausstellung Landesmuseum Kärnten vom 3. Juni bis 13. August 2014
(c) Öbb-Ausstellung
Klagenfurt- 2012 feierte die Eisenbahn in Österreich ihr 175 jähriges Jubiläum. Dabei wurden die enormen technischen Errungenschaften und die Bedeutung der Bahn für die industrielle Revolution, für Erneuerung und den wirtschaftlichen Aufschwung thematisiert. Die ÖBB haben sich aber auch mit den dunklen Zeiten des Systems Schiene beschäftigt. Es wurde auch die Zeit thematisiert, in der die Österreichischen Bundesbahnen (BBÖ) ein Teil der Deutschen Reichsbahn waren und eine der wichtigsten Stützen des nationalsozialistischen Staates in Österreich.
Mag. Christian Kern, CEO ÖBB Holding AG: „Das ist der dunkelste Abschnitt unserer Unternehmensgeschichte. Wir sind dazu verpflichtet zu gedenken und möchten mit dieser Dokumentation einen weiteren Beitrag zur historischen Aufarbeitung leisten. So unfassbar uns diese Ereignisse heute erscheinen, so klar müssen wir als ÖBB diese Zeit als Teil unserer Geschichte akzeptieren“
„Gerade vor dem Hintergrund eines Anstiegs des autoritären anti-demokratischen Potenzials bei jungen Menschen in Österreich, sind Aktivitäten wie das Lehrlingsprojekt der ÖBB mehr als ein Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit der Unternehmensgeschichte in der NS-Zeit. Die Ausstellung ist auch ein Beitrag zur politischen Bildung und Stärkung der demokratischen Grundstimmung in Österreich.“ meint Univ. Prof. Dr. Oliver Rathkolb, wissenschaftlicher Berater der Ausstellung.
Loibltunnel-Bausstelle, vermutlich 1943
(c) Mauthausen Komitee Kärnten
Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Wien, Steiermark und Kärnten:
„Einerseits war die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Kärnten auf allen Ebenen bereits sehr früh vollzogen. Andererseits gab es in Kärnten den bedeutenden, kontinuierlichen und organisierten Widerstand, bestehend aus verschiedenen Gruppierungen, gegen die Nazi-Diktatur.
Um aber der Verdrängung entgegenzuwirken, ist Geschichtsaufarbeitung und die für diese Ausstellung gewählte greifbare Form besonders wichtig. Die Fragen „Wie ist alles vor sich gegangen?“ oder „Wie war das möglich?“ sind in dieser Ausstellung kein Tabu und es wird wohl kein Besucher davon unberührt bleiben.“
Peter Kaiser, Alisa Tennenbaum, Oskar Deutsch
(c) Landesmuseum Kärnten Rudolfinum
David Glesinger, Sohn eines jüdischen Rechtsanwalts aus Villach:
„Ich bin 1937 als Sohn eines österreichischen Patrioten und jüdischen Rechtsanwalts in Villach geboren. Wir mussten nach dem Einmarsch flüchten, mein Vater bekam Berufsverbot und ein Teil unserer Flucht war nur mit der Bahn möglich. Danke für diese Ausstellung, damit auch hier in Kärnten vor allem die jungen Menschen sehen, was sich nie mehr wiederholen darf.“
Alisa Tennenbaum:
„Ich halte es für sehr wichtig zu erzählen was in den Jahren von 1938 – 1945 in Europa vorgefallen ist. Leute zu hassen und zu vernichten darf nie mehr geschehen. Jeder muss auf den andern schauen und mitfühlen und versuchen zu verstehen, niemand ist berechtigt dass Leben einer Person zu nehmen nur weil der Mensch eine andere Farbe, Religion hat, weil er „anders“ ist. Die Gräueltaten des Holocaust dürfen nie wieder passieren und sie dürfen nicht vergessen werden.“ Alisa Tennenbaum, konnte sich mit dem „Kindertransport“ nach England retten, ihre Geschichte wird in der Ausstellung erzählt.
Die Ausstellung
Diesem Zeitabschnitt ist die Themenausstellung „Verdrängte Jahre – Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938 – 1945 gewidmet, die ab 3. Juni im Landesmuseum Kärnten (Museumgasse 2, 9021 Klagenfurt) zu sehen.
Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Freitag 10 – 18 Uhr, Donnerstag 10 – 20 Uhr,
Samstag, Sonntag, Feiertag 10 – 17 Uhr
Eckpunkte der Themenausstellung
Verdrängte Jahre
Obwohl die Bahn in der Zeit des Nationalsozialismus eine zentrale Rolle spielte, blieb sie in der Geschichtsschreibung der Österreichischen Bundesbahnen bisher so gut wie unerforscht und ausgeblendet. Die Österreichischen Bundesbahnen wurden 1938 sofort in die Deutsche Reichsbahn integriert. Ohne Bahn als Transportmittel wäre die Kriegslogistik der deutschen Wehrmacht nicht machbar gewesen.
Züge in den Tod
Ohne die logistische Kapazität der Bahn wäre der systematische Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden, an Roma und Sinti, die Deportation von Sloweninnen und Slowenen, von Homosexuellen, Zeuginnen und Zeugen Jehovas und politisch Andersdenkenden nicht möglich gewesen. Drei Millionen Menschen aus fast ganz Europa wurden im Zweiten Weltkrieg mit Zügen in die Vernichtungs- und Tötungslager des NS-Regimes transportiert.
Die Deutsche Reichsbahn war durch die Deportation zahlloser Menschen unmittelbar am Holocaust beteiligt und mit ihr auch die ehemals österreichischen Bahnbediensteten, die während der Zeit - nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland und dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 Bedienstete der Deutschen Reichsbahn waren.
Über 200.000 Österreicherinnen und Österreicher, fast die gesamte jüdische Bevölkerung wurden gezwungen ihre Heimat zu verlassen oder in Konzentrations- und Vernichtungslager geschickt. Die Transporte erfolgten mit der Bahn.
Eisenbahner im Widerstand
Die nationalsozialistischen Machthaber versuchten von März 1938 die Eisenbahnbediensteten an ihr Regime zu binden. Eisenbahnerinnen und Eisenbahner hatten strengere Regeln als Berufsbeamte zu befolgen, mussten „jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintreten“ und sie wurden flächendeckend einer politischen Untersuchung und Überwachung unterzogen. Dennoch waren Eisenbahnerinnen und Eisenbahner maßgeblich am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt.
So berichtet das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 1941 über den Widerstand bei der Bahn, dass im Vergleich zum „Altreich … die Ostmark seit Ausbruch des Krieges 1939 in sabotagepolizeilicher Hinsicht eine größere Rolle spielte, da hier die fremdländischen Nachrichtendienste und die inländischen Gegnergruppen es bereits früher verstanden hatten, Sabotageorganisationen aufzubauen, …“ 154 Eisenbahner wurden wegen Ihres Widerstandes zum Tode verurteilt und hingerichtet, 135 starben in Konzentrationslagen oder Zuchthäusern, 1.438 wurden zu KZ- oder Zuchthausstrafen verurteilt.
Themenausstellung: Verdrängte Jahre
Die Themenausstellung gliedert sich in die Abschnitte + Der »Anschluss« + Die Bahnbediensteten + Emigration und Kindertransporte + Die Sondertransporte + Der Widerstand +Die Zwangsarbeit + Das »arisierte« Vermögen +Die Restitution.Diese Ausstellung betrachtet auch die Rolle der Bahn in dieser Zeit speziell in der Region Kärnten. So wird genauer auf die Zwangsarbeit am Loibl Pass, die Verschickung und das Los der slowenischen Bevölkerung und auch über das Ende des jüdischen Lebens eingegangen und natürlich wird der Widerstand der EisenbahnerInnen, der in der Region sehr stark war, es wurden viele Todesurteile ausgesprochen, auch in einer speziellen Tafel behandelt.
Teil der Themenausstellung ist eine filmische Dokumentation, die ÖBB-Lehrlinge im Gespräch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zeigt.
Führungen
Führungen werden am 23. Juni von 13 bis 16 Uhr, am 24. und 25.Juni von 8.30 bis 15.30 Uhr
mit Anmeldung angeboten.
Terminvereinbarung für Führungen:
Agentur Milli Segal Tel.: 01 9687266, Mobil: 0664 3098132, Email: milli.segal(at)chello.at
Mag.a Gudrun Blohberger – Landesmuseum Kärnten
Tel.: 050536 40565, Email gudrun.blohberger(at)landesmuseum.ktn.gv.at
In Kooperation mit dem BMUKK/www.erinnern.at wird Schülerinnen und Schülern entsprechendes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt.
Konzeption und Umsetzung der Themenausstellung: Dr.in Traude Kogoj (Projektleitung), Milli Segal (Ausstellungskonzeption)
Weitere Informationen zum Gesamtprojekt finden Interessierte unter:
Gesamtprojekt unter: www.oebb.at/verdraengte_jahre
Alisa Tennenbaum
(c) Yad Layeled
Ich heiße Alisa. ich bin am 3. September 1929 in einer traditionellen jüdischen Familie in Wien geboren. Meine Schwester Myriam war damals 7 Jahre alt. Mein Vater Moshe Scherzer war in Österreich geboren und meine Mutter Edith in Galizien, im Süden Polens. Meine Eltern hatten ein Geschäft für Hülsenfrüchte. Wir waren nicht reich aber wir litten keinen Mangel. Ich bin in eine gemischte Schule gegangen, mit Juden und Christen.
Zum Zeitpunkt des Anschlusses, am 12. März 1938, war ich in der Schule. Alle jüdischen Kinder sind von der Schule verwiesen worden. Ende Mai 1938 ist eine Schule für jüdische Kinder eröffnet worden, aber am 10. November, einen Tag nach der „Kristallnacht“, hat die Schule geschlossen. Das war sehr gefährlich, alle Kinder sind nach Hause gegangen.
Am selben Tag ist eine Frau gekommen, um uns von der Verhaftung meines Vaters zu informieren. Zehn Tage später haben wir von Papa eine Karte aus dem Lager Dachau bekommen.
Alle Juden haben versucht ein Visum für Palästina zu bekommen, aber nur 60 Jugendliche haben eines erhalten.
Meine Schwester wollte auch wegfahren. Meine Mutter war zuerst dagegen, hat ihr dann aber einen Koffer mit allem Nötigen für ihre Abreise gekauft. Myriam hat Österreich am 7. Januar 1939 mit einer Gruppe Jugendlicher verlassen können.
Am 27. Januar 1939 hat die Schule für jüdische Kinder wiederaufgemacht. Ich war im Unterricht als eine Nachbarin gekommen ist, um mir zu sagen, dass mein Vater aus Dachau befreit worden war. Ich bin nach Hause gelaufen. Ich habe meinen Vater nicht wiedererkannt. Er saß auf dem Bett und weinte. Sein Kopf war kahl geschoren. Papa hatte drei Monate, um Osterreich zu verlassen und durfte nur einen einzigen Koffer mitnehmen.
Dank eines Briefes unserer Angehörigen, die in Kanada lebten, hat Papa ein Visum für Großbritannien bekommen. Am 13. April 1939 hat er mit anderen Gefangenen aus Dachau den Zug genommen. Sie sind in einem ehemaligen Militärlager in der Nähe der Stadt Kent untergebracht worden. Papa hat versucht, uns, Mama und mich, nach Großbritannien nachkommen zu lassen.
Mama hat mich in einen Kindertransport eingeschrieben. Am 22. August 1939 habe ich den letzten Zug genommen, der Österreich vor dem Krieg verlassen hat. Mama ist in Österreich geblieben. Wir waren 600 Kinder.
In London hat man uns in einem großen Amphitheater versammelt. Ich habe in der Menge, die gekommen war, um die Kinder abzuholen meinen Vater gesucht, aber er war nicht da. Am Ende blieben nur ich und ein kleiner Junge übrig.
Man hat mir ein paar Worte um den Hals gehängt: Richtung New Castle. Ich habe allein den Zug genommen. Ich habe die ganze Fahrt über geweint. Ich hielt ein Deutsch-Englisches Wörterbuch in der Hand. Ein Priester und eine Frau die Deutsch sprachen, haben mich beruhigt und mir geholfen am richtigen Bahnhof auszusteigen.
Zwei jüdische Frauen, die sich um die Flüchtlingskinder kümmerten, erwarteten mich bei meiner Ankunft. Sie haben mich in ein Mädchenpensionat gebracht. Wir waren in drei Gruppen aufgeteilt: die Großen, die Mittleren und die Kleinen. Ich war eine „Mittlere“. Zwei Tage nach meiner Ankunft bin ich in die Schule gegangen. Die Lehrerin hat mir sehr geholfen.

