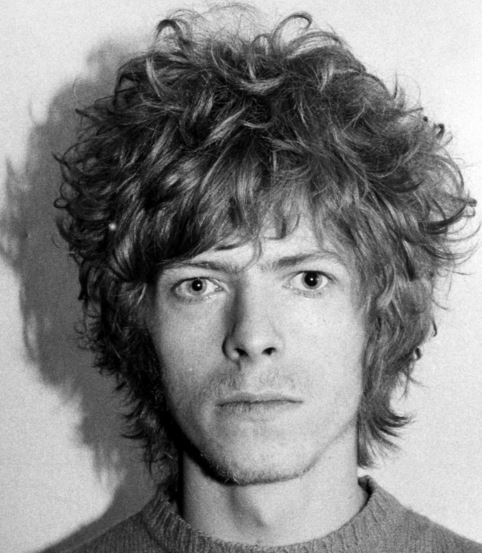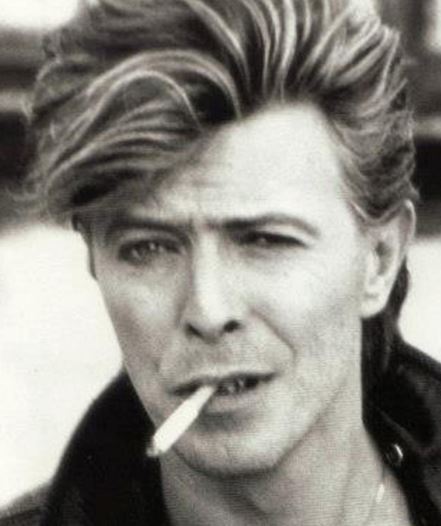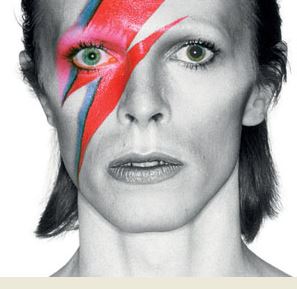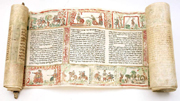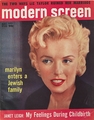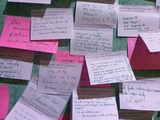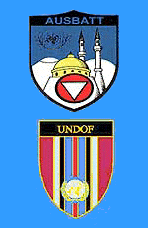Um Israel zu verstehen, muss man den Holocaust verstehen
Von Ben Caspit
Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem ein Drittel des jüdischen Volks von der präzise geplanten, nie dagewesenen Tötungsmaschinerie der Nazis vernichtet wurde, ist das Trauma noch immer in die kollektive DNA der Israelis eingebrannt, als wäre es erst vergangene Woche geschehen. Die Generation der Überlebenden wird immer kleiner. Es sind nur noch 200.000 Israelis am Leben, die den Horror selbst miterleben mussten. Aber die zweite und dritte Generation steht an der Seite ihrer Eltern und Großeltern im Schatten der Gaskammern und gelobt, nie zu vergessen und „Nie wieder!“ (…)
Um zu verstehen, wie schwer es sein wird, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen, ist es nötig einen tiefen Einblick in das israelische Erleben des Holocaust zu haben. Dem Knesset-Abgeordneten Dr. Ahmed Tibi, vielleicht der bekannteste israelisch-palästinensische Parlamentarier, wenn es um den Konflikt geht, ist dies gelungen. Anstatt den Holocaust zu leugnen, hat er ihn studiert. (…) Seine Rede vor der Knesset vor wenigen Jahren (Januar 2010) war eine der wichtigsten und auch eine der fesselndsten, die je über dieses Thema im israelischen Parlament gehalten wurde, besonders auch, da es ein palästinensischer Patriot war, der sie hielt. Tibi sagte, es sei die Pflicht eines jeden Menschen, allein schon, weil er ein Mensch ist, zu wissen, was damals geschah und zu erkennen, dass dies das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, das jemals in der Geschichte der Menschheit verübt worden ist. Nachdem er das sagt, vergisst er nie anzumerken, dass die Tatsache, dass Juden Opfer dieses schrecklichen Verbrechens wurden, ihnen nicht das Recht gibt, ein anderes Volk ebenfalls zu Opfern zu machen. (…)
In Israel wird momentan eine komplexe Debatte darüber geführt, welche Rolle der Holocaust in Israels Alltag spielen soll, und wie an ihn erinnert werden sollte. Einige argumentieren, der Holocaust könne mit nichts verglichen werden. Der Begriff „Shoah“ solle in keinem anderen Zusammenhang genutzt werden. (…) Sie lehnen es zum Beispiel ab, das iranische Streben nach Atomwaffen mit Adolf Hitler zu vergleichen. Sie erwidern wütend, wenn Ministerpräsident Binyamin Netanyahu davon spricht, dass eine „zweite Shoah“ verhindert werden müsse: „Wie kann er die Millionen hilfloser Juden, die in Europa im vergangenen Jahrhundert in den Tod geschickt wurden, während die Alliierten und der Westen wegsahen und sich sogar weigerten, die Todeslager zu bombardieren, mit der heutigen Situation vergleichen, in der Israel eine Regionalmacht ist mit der stärksten, besttrainierten und bestausgerüsteten Armee des Nahen Ostens (…)?“

Binyamin Netanyahu bei seiner Rede an Jom HaShoah in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem (Foto: Amt des Ministerpräsidenten)
Es gibt auch jene mit der gegensätzlichen Ansicht, angeführt von Netanyahu. Diese Gruppe glaubt, dass das tägliche erinnern an den Holocaust und die Lehren, die aus ihm gezogen werden können, die ultimative Mitzvah und ein Akt von quasi-religiöser Bedeutung ist. (…) Bibi ist damit nicht allein. Der Schriftsteller A.B. Yehoshua, eines der herausragenden Symbole der israelischen Linken und Netanyahu politisch entgegenstehend, stimmt ihm in diesem Punkt vollkommen zu. Er glaubt, das jetzige militärische Können Israels ist irrelevant angesichts der Möglichkeit, dass es durch Nuklearwaffen ausgelöscht werden könnte. Die Möglichkeit eines zweiten Holocaust nehme vor unseren Augen Gestalt an. Warum sollten wir still dasitzen und warten? Warum sollten wir zulassen, dass es wieder geschieht? (…)
Unabhängig von der Position, die jeder in diesem Punkt vertritt, ist die Gefahr eines Holocaust in den Köpfen und Gedanken der Israelis heute so gegenwärtig wie vor über einem halben Jahrhundert. (…) Israelis werden in dieses Trauma hineingeboren. Sie leben es, atmen es und wachsen auf mit dem Bewusstsein, die einzige Nation in der Geschichte zu sein, gegen die eine gutfunktionierende und effiziente Vernichtungsmaschinerie eingesetzt wurde, und dass sie das einzige Volk sind, dass in Massen in ein gigantisches Schlachthaus getrieben wurde, nicht weil sie einen Krieg verloren haben, nicht weil sie ein Verbrechen begangen hätten, sondern nur aus einem Grund. Weil sie existierten. (…)
Jeder, der plant, die Ärmel hochzukrempeln und seine Hände in dieses Pulverfass zu tauchen, sollte alles wissen über diese ewige Flamme, die unter ihm brennt. Dies gilt nicht nur für die Menschen, die in diesem Konflikt vermitteln, sondern auch, und besonders, für unsere Gegenspieler und Partner im Konflikt wie die Palästinenser. (…)
(Al-Monitor, 09.04.13)
Der Autor ist ein israelischer Journalist. Er ist hauptsächlich für die israeliche Zeitung Ma"ariv tätig.
Hamas versucht vermehrt, israelische Soldaten zu kidnappen
Seit Anfang des Jahres verzeichnete Shin Bet im Westjordanland einen dramatischen Anstieg bei Versuchen der Hamas, israelische Soldaten zu entführen. Bereits 33 Entführungsversuche gab es 2013 verglichen mit insgesamt 24 im letzten Jahr.

Soldatin (Foto: Archiv)
Hochrangige IDF-Offiziere warnten bereits in den vergangenen Monaten vor den Aktivitäten der Hamas, die entführten Soldaten als „Verhandlungsmasse“ zum Freipressen palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen zu missbrauchen.
Laut Aussage von Shin Bet wurden einige der Entführungsversuche nur wenige Stunden vor der geplanten Ausführung vereitelt.
Der Deal, der zur Freilassung von Gilad Shalit führte, hatte die Hamas verstärkt angereizt, israelische Soldaten zu entführen, sagte ein hochrangiger IDF-Vertreter. Solche Entführungen seien mit zwei bis drei bewaffneten Terroristen leicht zu realisieren.
„Die Hamas ist sich dessen bewusst, dass es schwierig ist, Raketen im Westjordanland zu platzieren und auf Israel auszurichten. Deshalb geht die Hamas erfolgversprechendere Methoden an“, sagte der IDF-Vertreter.
„Unsere Ermittlungen innerhalb der Hamas zeigen uns die Dreistigkeit dieser Entführungen. Bisher waren wir in der Lage, Entführungen zu vereiteln, aber der Umfang ist außergewöhnlich hoch und es ist nicht klar, wie lange wir diese Versuche noch verhindern können“, ergänzte er.
Um Entführungen zu verhindern, hat die IDF ihre Verhaltensrichtlinien für Soldaten verschärft. So ist es ihnen beispielsweise nicht mehr erlaubt zu trampen.
Grußwort des Präsidenten des Staates Israel
Shimon Peres an die Jüdischen Gemeinden in der Diaspora
anlässlich des 65. Unabhängigkeitstages Israels

Liebe Freunde,
es ist mir eine Ehre und eine große Freude, Sie einzuladen, an den
Feierlichkeiten anlässlich Israels 65. Unabhängigkeitstag teilzunehmen. Es ist ein Tag der Freude und des Feierns, und eine Zeit immensen Stolzes für
unser Land und seine Menschen, auch für unsere Brüder und Schwestern im Ausland, in der bemerkenswerte Errungenschaften in nur etwas mehr als
sechs Jahrzehnten erreicht wurden, gemeinschaftlich mit Ihnen – unserer
Großfamilie.
Es ist auch die Zeit jenen Tribut zu zollen, die ihr Leben gaben, um unsere
Nation zu schützen und denen wir ewig dankbar sein sollten. Als Nation und als Individuen schulden wir ihnen der Freiheit und des Friedens Willens, diese Werte aufrecht zu erhalten und sie mit all unserer Macht zu verteidigen.

Es ist aber nicht nur unsere Pflicht zu erinnern, sondern auch zu handeln.
Es besteht eine reale Chance auf Frieden. Unsere letzten Wahlen, der
Besuch von US-Präsident Obama in Israel und die rasanten Veränderungen
in unserer Region bergen ein Fenster der der Möglichkeiten. Es ist an jedem
von uns, diese Chance zu ergreifen und sie eine neue Realität zu
transformieren, zum Wohl unserer zukünftigen Generationen. Es ist an Ihnen, das Fenster zu öffnen.
Das ist keine einfache Aufgabe. Wir brauchen Courage und Beharrlichkeit
ebenso wie unsere Partner weltweit, um gemeinsam für Veränderungen zu
kämpfen. Meine Freunde, unser Erbe lehrt uns, dass die Grundsätze von
Gerechtigkeit und Frieden für eine bessere Welt um uns herum gewahrt sein müssen – Tikkun Olam.
Gemeinsam können wir eine lichtere Zukunft bauen;
ein bedeutendes Vermächtnis für die zukünftigen Generationen, getreu
unserer jüdischen Seele, die von Partnerschaft und Verantwortung geprägt ist !��� ����
��
Shimon Peres
15. April 2013
4. Ijar 5778
PM Netanyahu's Independence Day Message to Israeli Citizens

Dear citizens of Israel, On the 65th Independence Day, we are proud of our state: a state that has gathered the Jewish exiles into the Land of Israel; a state that is at the forefront of global technology; a state with a strong army and a strong economy; an exemplary democracy for all its citizens; a state that is a home for every Jew.
All of this was achieved thanks to you, thanks to each and
every one of you. On Independence Day we look to the future with confidence. I believe in Israel's strength, its spirit, its capabilities.
I don't belittle the challenges before us, but knowing all that we have done
here, all that we have been through, all that we have built, I believe that we are ready for any challenge.
Happy Independence Day.
(Communicated by the Prime Minister's Office)
(Translated from Hebrew)
15. April 2013
Ungeheuerliche Störung des Gedenkens an die jüdische Brigade in Italien
von Comunità Ebraica di Roma , übersetzt von Alessandro Volcich

Italien ist frei. Auch dank der Jüdischen Brigade. Und so weht das Banner derjenigen Gruppe, die während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit den anderen Partisanen die deutsche Armee vom italienischen Boden gejagt haben, wieder auf der Kundgebung am 25. April.
Es ist 9:30 als das Transparent der Brigade beim Kollosseum erhoben wird, um den Spaziergang zu Porta San Paolo zu beginnen. Es erheben sich auch andere Fahnen. Auf der vorderen Seite des Demonstrationszuges die der Partisanenverbände, weiter hinten die Zeichen der Gewerkschaften, einiger politischer Parteien und von Tierschützervereinen oder Vereinen zum Schutz des öffentlichen Wassers.
Auch einige Palästina-Fahnen stechen hervor. Eine hat das Gesicht Arafats drauf gedruckt. Die Kundgebung anlässlich des jahrestags der Befreiung sieht wie ein ungeordneter Mischmasch aus. Es gibt alles. Es gibt die Organisationen zur Befreiung Öcalans ... Ein Schriftzug mit 20 Personen, der dazu einlädt den Hunden eine Stimme zu geben, die nicht selbst protestieren können. ...
Es ist bald 10 Uhr. Es geht los. Nein, doch nicht. Ein Vertreter der ANPI, die Organisatoren der Kundgebung, nähert sich der Jüdischen Brigade. Er sagt, dass die Fahne mit dem Davidstern runter genommen werden müssen, das Transparent darf nur erhoben werden, wenn man bei San paolo ist. Der Präseident der römischen Vereinigung der Freunde Israels, Alberto Tancredi, kann das nicht glauben. Er versucht zu verstehen.
Der Vizepräsident der Jüdischen Gemeinde Roms, Giacomo Moscati, regt sich auf. Er antwortet darauf. Erzählt ein Stück der Geschichte der Brigade, das was sie für Italien gemacht hat, vom Blut, den Toten, dem Opfer für das Land. Und dann ist da unten die Palästinafahne. Wenn es die gibt, warum muss die israelische runter genommen werden? Und so beginnt der Mann der ANPI zu verstehen. Er zieht sich zurück.
Diesmal ja, geht es los. Der Demonstrationszug beginnt loszuamrschieren. Es ist ein Fest. Wie immer. Mit einer Tänzergruppe, die mit dem Rythmus der Trommeln voranschreitet. Jemand hebt zu "Bella Ciao" an. Andere geben den Rythmus mit Pfeifen vor. ...
Und so, um 11.30 herum, zieht man bei Porta San Paolo ein. Die Jüdische Brigade tut sich zusammen, stellt sich auf die linke Seite vor der Bühne (wie letztes Jahr). Der Platz füllt sich. Alle Abordnungen kommen nach. Und die Reden beginnen. Auf einmal tauchen ein paar ausländische Jungs mit der Palästina-Fahne in der Hand auf, die sich unter die Israel-Fahnen mischen. Es passiert nichts.
Aber einer der beiden beginnt die Mitglieder, die mit der Brigade marschiert sind, zu provozieren. Jemand mit der Kippa am Kopf antwortet, dass er wo anders hingehen soll, um zu provozieren, dass er zum Platz zurückkehren soll, der ihm angewiesen wurde (der 50 Meter entfernt ist). Aber diese Hinweise nützen nichts. Es fliegen einige schwere Wörter.
Vorwürfe über Israel.
Die Lage erhitzt sich immer mehr. "Ihr seid schlimmer als die SS", hat einer der Unterstützer der Palästinenser gesagt, die nun zu einem Dutzend angeschwollen sind. Gesicht an Gesicht steht man sich konfrontierend gegenüber. Hart, aber ohne je handfest zu werden. Der Ordnungsdienst der ANPI probiert zu schlichten. Es dauert ein bisschen, aber die Gemüter legen sich als die Palästina-Fahnen zurück zu ihrem Platz kehren.
Mittlerweile geht die Kundgebung auf der Bühne weiter. Die Reden setzen sich fort, unterbrochen von einigen musikalischen Einspielungen. Ehemalige Partisanen, Frauen und Nachkommen derjenigen, die die Geschichte des Widerstands gemacht haben, erinnern sich der Werte in denen das Nachkriegs-Italien geboren wurde.
Am Ende der offiziellen Zeremonie kommen die Reden der Vertreter der Gruppen des Demonstrationszuges dran. Auch die Jüdische Brigade hatte sich angemeldet, um zu reden. Alberto Tancredi hatte offiziell darum angefragt, indem er in der letzten Sitzung des Organisations-Komittees der ANPI, an dem die Gruppen teilgenommen haben, ein Formular ausgefüllt hat.
Um 12.30 nähert sich Tancredi der Bühne, fragt den Ansager: "Wann bin ich dran?". Der Ansager sieht auf sein Blatt: "Du stehst da nicht oben, du sollst nicht sprechen. Frag die Organisatoren." Tancredi bleibt fassungslos, sucht die von der ANPI. Er findet sie. Verlangt eine Erklärung. Und kommt zur Jüdischen Brigade zurück ohne seine Rede gehalten zu haben: "Sie haben mir gesagt – erkärt er den anderen – es wurde beschlossen, dass es besser sei niht zu reden, weil es zu Unordnung mit den anderen Gruppen kommen könnte." Nichts zu machen. Die Kundgebung löst sich auf. Das Fest ist vorbei
Offener Brief - Nakb​a-Ausstellung beim E​vangelischen Kirchen​tag ausladen​
Absender: DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Befremden haben wir erfahren, dass auf dem diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentag die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 des Vereins Flüchtlingskinder im Libanon e. V .auf dem Kirchentag von 1.- 4. Mai 2013 gezeigt werden soll.
Diese Ausstellung ist, wie die InitiatorInnen selbst auf ihrer Webseite dokumentieren (s. u.) – leider in der Kommentierung sehr einseitig und wenig differenziert –, hoch umstritten und in verschiedenen Orten schließlich nicht gezeigt worden. Dies hat seinen Grund darin, dass die Darstellung der Ausstellung tendenziös, im Kern antizionistisch und unseriös die Geschichte des Konfliktes im Nahen Osten darstellt.
In dieser Ausstellung wird die Gründung des Staats Israel 1948 als Höhepunkt einer illegitimen Landnahme beschrieben, mehr noch: Durch den Begriff 'Nakba' wird die Gründung des Staates Israel zu einer Katastrophe erklärt und damit schon im Titel deutlich gemacht, welches Wunschziel der Ausstellung zugrundeliegt und sie in ihrer Botschaft an Betrachtende charakterisiert: die Abschaffung des jüdischen Staates.
Wir protestieren nachdrücklich dagegen, dass der evangelische Kirchentag solche Propaganda im Programm zulässt und fordern Sie auf, die Ausstellung auszuladen.
Die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 betreibt unverhohlene Geschichtsklitterung und der Zweck, der damit verfolgt werden soll, ist die Delegitimierung und Dämonisierung des jüdischen Staates. Wir illustrieren dies an drei Beispielen.
Es wird in den Tafeln der Ausstellung wiederholt behauptet, dass es vor der Gründung Israels eine palästinensische Nation gegeben habe, deren Land durch die Balfour-Erklärung von 1917 jüdischen Einwanderern versprochen worden sei. Eine solche Nation (in jedem Sinne des Wortes 'Nation') hat es nie gegeben, es ist auch umstritten, ob es sinnvoll ist, von einem "palästinensisches Volk" zu sprechen, wie es in der Ausstellung geschieht.
Im Gegenteil legt die Balfour-Erklärung fest, dass es einen jüdischen Staat geben soll, und spricht überhaupt nicht davon, ob es einen arabischen Staat geben soll oder nicht. Die Ausstellung stilisiert die Balfour-Erklärung geradezu als "Sündenfall", weil überhaupt jemand gewagt hatte, das Recht der im britischen Mandatsgebiet ansässigen und der zuwandernden Juden auf einen selbstverwalteten Staat zu erklären.
Viel wichtiger als die Balfour-Erklärung für die Gründungsgeschichte ist überdies der Teilungsplan der Vereinten Nationen von 1947, der explizit erstmals einen arabischen Staat sowie einen jüdischen Staat vorsieht. Allerdings kam es wohl zur Gründung eines israelischen Staates, aber nie zur Gründung des vorgesehenen arabischen Staates, weil die einflussreichsten politischen Kräfte in den arabischen Bevölkerungen außerhalb von Israel bis heute damit beschäftigt sind, ultimativ die Vernichtung Israels zu planen und propagandistisch vorzubereiten und keineswegs Interesse zeigen, einen Staat Palästina zu errichten, der seinen Bürgern – und einem Teil der Flüchtlingsnachkommen – eine verfasste Staatsbürgerschaft geben könnte.
Schon gleich nach der Gründung Israels 1948 fielen die jordanische, irakische, syrische und ägyptische Armee über den jungen Staat her. Der Termin dieses Angriffs zeigt, dass es grundsätzlich gegen die Gründung des jüdischen Staates, die von der UN-Vollversammlung beschlossen worden war, ging und keine Rede davon sein kann, dass irgendwer irgendwem anders etwas "weggenommen" hätte.
Die Einlassungen der Ausstellung darüber, wie die Gründung des Staates Israel (und die vorgesehene, aber nicht erfolgte Gründung eines arabischen Nachbarstaates) verlief, zeichnen ein viel zu einfaches und einseitiges Bild und suggerieren, dass "der Zionismus" (der als "Wurzel des Palästina-Problems" bezeichnet wird) "die Palästinenser" "ihrer Heimat und ihres Besitzes beraubt" hätte und zu einem "Volk von Flüchtlingen" gemacht habe.
Der ultimative Grund dafür, dass der Staat Israel gegründet werden musste – die Vernichtung der Juden durch den deutschen Nationalsozialismus–, wird an wenigen Stellen nebensächlich erwähnt und dann lediglich, um deutlich zu machen, dass "die einheimische arabisch-palästinensische Bevölkerung" leidtragend sei (Tafel 2).
Aus Auschwitz folgt aber unmittelbar die Einsicht, dass Juden als Verfolgte sich nicht darauf verlassen können, von nicht jüdischen Staaten, Parteien, Kirchen und Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Kräften wirksam geschützt zu werden, wenn man sie vernichten will.
Deshalb ist ein jüdischer Staat als Lebensversicherung, mit den Gewaltmitteln zur Sicherung der Existenz und Unversehrtheit seiner Bürger, die einem jedem modernen Staat zur Verfügung stehen, absolut notwendig.
Die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 hingegen gibt als Grund für die Gründung Israels vage den Zionismus an, der erscheint in den Tafeln der Ausstellung sowie in der Broschüre zur Ausstellung wie das Partikularinteresse einer kleinen Gruppe, wobei die Notwendigkeit einer Heimstatt für alle Juden nach den historischen Erfahrungen, die in der Shoah kulminierten, ignoriert wird.
Damit stellt die Ausstellung die Gründung Israels grundlegend verzerrt dar. Sie macht die jüdischen Einwanderer und späteren Israelis pauschal zu Landräubern und unklar motivierten feindseligen Zerstörern und verbannt den Charakter Israels als Lebensversicherung der Juden vage in Fußnoten.
Schließlich werden durch die Ausstellung im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitskrieg systematisch Feindseligkeiten arabischer Bevölkerungsteile gegen Juden (sowohl im 20. Jahrhundert einwandernde Neuankömmlinge als auch gegen den 1948 seit Jahrhunderten ansässigen Yishuv) ausgeblendet. Beispielhaft für diese Feindseligkeiten steht der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, der als zentrale Figur der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Mandatsgebiet der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zu betrachten ist und daher stellvertretend für das Ressentiment weiter arabischer Bevölkerungskreise gelten kann.
Der Großmufti war ein glühender Antisemit, der hoffte, dass das nationalsozialistische Deutschland nach der "Lösung der Judenfrage" in Europa gemeinsam mit ihm und seinesgleichen Gleiches im Nahen Osten vollziehen möge und der bereits im Vorhinein in höchstem Maße aktiv zur geplanten Auslöschung des Judentums beitrug.
Die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 zeichnet demgegenüber ein Bild der arabischen Bevölkerung als in der Gesamtheit friedliche agrarische Gesellschaft, die von Horden jüdischer Terroristen und Soldaten unschuldig überfallen, beraubt und massakriert worden sei. Abgesehen davon, dass es nur sehr wenig Raub des Landes im Mandatsgebiet gab (die allergrößte Teil wurde tatsächlich rechtmäßig käuflich erworben) und Massaker allenfalls die Ausnahme waren – und nicht wie die Ausstellung suggeriert, die Regel – lässt eine solche Darstellung vollkommen außer Acht, dass es bereits seit 1920 und bis weit in die späten 30er-Jahre judenfeindliche Pogrome arabischer Kräfte gab, die Ausdruck eines verbreiteten Antisemitismus in der arabischen Gesellschaft des Mandatsgebiets waren.
Diese grundsätzlich judenfeindliche Haltung hält bis heute in großen Teilen der palästinensischen Gesellschaften an. So bezeichnet die im Gazastreifen herrschende Hamas israelische Städte wie Aschdot und Sderot als „besetztes Gebiet“ und beteuert , keine Juden auf "palästinensischem Boden" dulden zu wollen – eine notdürftig verklausulierte Ankündigung, den Staat Israel und seine Einwohner zu vertreiben respektive zu vernichten.
Währenddessen leben im Staat Israel rund 20% arabische Staatsbürger, die dieselben Bürgerrechte haben wie jüdische Israelis und dort ein besseres und freieres Leben haben als beliebige arabische Einwohner im Gazastreifen unter der Hamas oder im Westjordanland unter der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die Flüchtlinge, um deren Wohl besorgt zu sein die Ausstellung suggeriert, leben heute in Libanon, Syrien und Jordanien, zum Teil unter schwierigsten Bedingungen. Die Flüchtlinge und ihre Nachkommen, die als einzige Flüchtlingsgruppe der Welt den Status von Flüchtlingen erben, werden bis heute nicht in die aufnehmenden
Gesellschaften integriert und als Faustpfand gegen Israel benutzt, anstatt dass ihnen ein gutes und würdiges Leben erlaubt und ermöglicht würde.
Dies erwähnt die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 ganz am Ende im Kleingedruckten (Tafeln 10 und 11), aber erst nachdem auf den 9 Tafeln zuvor Israel und die Juden (unter dem Label "Zionisten") einseitig als Übeltäter beschrieben worden sind.
Schließlich werden die aus den umliegenden arabischen Staaten nach 1948 geflüchteten und vertriebenen Juden verschwiegen, die nach Israel kamen und dort als volle Staatsbürger integriert wurden. Der Streit um genaue Zahlen oder gar eine Aufrechnung palästinensischer und jüdischer Flüchtlinge steht hier gar nicht zur Debatte.
Aber das Leid auf einer Seite lautstark zu beklagen und es fälschlicherweise ausschließlich der anderen Seite in die Schuhe zu schieben, und dann auch noch das Leid auf dieser anderen Seite zu verschweigen, ist schon Ausweis einer erheblich verzerrten und unausgewogenen Darstellung, und zeigt, dass Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 von Unversöhnlichkeit und Ressentiment geprägt ist.
Zusammenfassend zeichnet die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 ein völlig einseitiges Bild von denen, die pauschal als "Opfer des Zionismus" dargestellt werden, und vom Staat Israel, dessen Gründung insgesamt als moralisch verwerfliches Unternehmen gekennzeichnet wird, als Katastrophe für die arabischen Menschen, die im Mandatsgebiet lebten, alleine dadurch, dass es den Staat Israel gibt.
Der Antisemitismus in der arabischen Gesellschaft vor 1948, der weitverbreitete Wunsch nach der Auflösung Israels, der Missbrauch palästinensischer Flüchtlinge und ihrer Nachkommen durch die Israel umgebenden Staaten, die jüdischen Flüchtlinge nach 1948 kommen durchgängig nicht vor.
Neben diesen in Stichpunkten aufgeführten ausgewählten inhaltlichen Mängeln der Ausstellung gibt es eine Reihe weiterer politisch motivierter Unschärfen und auch mangelnde Klarheit in der Rezeption historischer Arbeiten. So wird der israelische Historiker Benny Morris zitiert als Zeuge dafür, dass es im Unabhängigkeitskrieg eine Politik der "ethnische[n] Säuberung" gegenüber Palästinensern gegeben habe (Tafel 5).
Tatsächlich widerspricht Morris dem deutlich in seinen eigenen Arbeiten; ihm wird aber hier, im Dienste der einseitigen Sache, kurzerhand in den Mund gelegt, was die InitiatorInnen für notwendig halten. Ähnlich verhält es sich mit einer Arbeit von Schreiber und Wolffsohn, die im Ausstellungskatalog häufig zitiert wird (Nahost. Geschichte und Struktur des Konflikts, 1993, Leske & Budrich).
Allerdings wird sie nicht sachgerecht zitiert, sondern sinnentstellend, so dass auch in diesem Fall man sich offenkundig Kronzeugen erschaffte, in dem man das, was sie schreiben, so herumdrehte, wie es ins eigene Kalkül passte [siehe Artikel in den Stuttgarter Nachrichten vom 17.11.2012: http://www.dig-stuttgart.net/
wp-content/uploads/2008/03/StN-121117-KonsternierteKronzeugen.pdf]
Die Ausstellungsmacher scheuten sich auch nicht, Geschichten zu erfinden, wie die Stuttgarter Nachrichten vom 10.11.12 aufdeckten:
In der Präsentation erzählt der fünf Jahre alteMohammad aus dem Flüchtlingslager Al-Rashidiya im Südlibanon von Flucht und Vertreibung: „Mein Vater ist psychisch schwer krank und kann nicht arbeiten.
Meine Eltern und wir sechs Kinder bekommen deshalb Lebensmittelpakete von der UNRWA“, sagt der Kleine. Unsere Zeitung wollte sich die Geschichte von Mohammad selbst erzählen lassen. Im Flüchtlingsdorf Al-Rashidiya unweit der Stadt Tyros erkannte keiner der Gesprächspartner den Jungen, der in der Ausstellung im roten Pullover lächelt.Schließlich ist auch die Geschichte um die Entstehung sowie die Vermarktung der Ausstellung instruktiv, wenn man einschätzen möchte, welche Motive die InitiatorInnen verfolgen.
Stolz präsentiert der Verein Flüchtlingskinder im Libanon e. V. auf der Seite <http://www.lib-hilfe.de/fakten_ausstellung_chrono.html>, dass die Ausstellung an jedem Ort, wo sie aufgestellt wird oder werden soll, auf Proteste und Kritik stößt. Dabei wird überwiegend wahrheitswidrig behauptet, die Proteste seien anonym – aber darauf, dass die Proteste damit zu tun haben könnten, dass die Ausstellung in ihrem Wesen falsch und diffamierend sein könnte, kommen die VeranstalterInnen nicht.
Vielmehr wird die allseitige Kritik zum Anlass genommen, sämtliche Individuen, Gruppen und Institutionen, die sich gegen die Nakba-Ausstellung aussprechen (DGB Frankfurt, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Tübingen, Stadtbibliothek Freiburg, verschiedene Arbeitsgemeinschaften der DIG, Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, VVN-BdA, Stadt Köln etc.) pauschal als diskussionsunwillig, querulantisch und aggressiv herabzusetzen.
Diese Praxis verdeutlicht bereits, dass der Hintergrund der Ausstellung keineswegs der Wunsch nach Aussöhnung oder differenziert-inhaltlicher Auseinandersetzung ist, sondern als Propagandaveranstaltung intendiert ist, die Kritiker von vorneherein diskreditiert und ihre Kritik als Indiz moralischer Verwerflichkeit ausweist.
Auf der anderen Seite finden sich in der Liste der Unterstützer der Ausstellung [http://www.lib-hilfe.de/fakten_ausstellung_unterstuetzer.html] allerhand Personen, die für ihre Einseitigkeit und tiefe Antipathie gegenüber dem Staat Israel weithin bekannt sind, z. B. Norman Paech, Annette Groth, Norbert Blüm, Johan Galtung und Günter Grass.
Norman Paech und Annette Groth sind gemeinsam mit islamistischen und rechtsgerichteten Aktivisten auf der Mavi Marmara mitgefahren, auf dem Schiff, das nach explizitem Bruch internationalen Rechts von der israelischen Armee geentert wurde, wobei nach Angriffen auf die Soldaten neun Tote zu beklagen waren. Im Nachgang sprach sich Norman Paech dafür aus, die deutsche Marine gegen Israel einzusetzen, Annette Groth trat wiederholt öffentlich als Augenzeugin der "Friedens"-Flotille auf und hetzte auf den Veranstaltungen unverhohlen gegen Israel (auf diesen Veranstaltungen von Frau Groth wurde unter anderem behauptet, der Antisemitismus sei eine Erfindung, um "uns Deutsche" kleinzuhalten).
Norbert Blüm bezeichnet in perfider Umkehr und in allzu durchsichtig sekundär antisemitischer Tradition das Verhalten der israelischen Armee im Konflikt mit arabischen Kräften, deren erklärtes Ziel es ist, Israel abzuschaffen, als "hemmungslosen Vernichtungskrieg".
Johan Galtung ist mittlerweile als Vertreter abstruser Verschwörungstheorien (u. a. behauptet er, der Mossad stecke hinter dem Anschlag von Anders Breivik auf ein norwegisches Jugendlager) und schäumender Feind Israels und der USA bekannt. Galtung wurde inzwischen sogar von der Universität Kiel ausgeladen, weil sie nicht mit Galtung assoziert werden möchte.
Günter Grass machte im vergangenen Jahr unter anderem von sich reden durch die groteske Behauptung, die israelische Regierung wolle das "iranische Volk auslöschen".
Während die bloße Assoziation der Ausstellung mit den Namen von diesen und anderen Unterstützenden an und für sich keine argumentative Kraft hat, verweist doch diese Unterstützerschaft exemplarisch darauf, welche Inhalte, Überzeugungen und Neigungen durch die fragliche Ausstellung transportiert und gefördert werden.
Zusammenfassend gibt es also mehrere Gründe, die schon auf den ersten Blick Zweifel aufkommen lassen daran, dass die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 ein angemessenes Bild der Gründungsgeschichte Israels zeichnet.
Das ist auch nicht weiter verwunderlich: die VeranstalterInnen selbst erklären in der Bröschüre zur Ausstellung, dass sie eine einseitige Sichtweise anstreben:
"Die aus der Ermordung von Millionen Juden im Nationalsozialismus erwachsene deutsche Schuld hat dazu geführt, dass Gesellschaft, Politik und Medien ganz überwiegend das israelische Verständnis dieses Zeitabschnitts verinnerlicht haben. Dadurch wurde der Blick auf das Leid des palästinensischen Volkes verstellt. Die Thematisierung der Flucht und Vertreibung dieser Menschen, erst recht ihrer Forderungen nach Rückkehr und Entschädigung, gilt bis heute vielfach als Tabubruch." [Die Nakba. Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung, download am 3.4.2013 von http://www.lib-hilfe.de/mat/ausstellung/Broschuere_Nakba.pdf]
Wir verwahren uns gegen die Behauptung, dass der "Blick auf das Leiden des palästinensischen Volkes" verstellt wurde, schon gar nicht ist dies geschehen dadurch, dass das "israelische Verständnis dieses Zeitabschnitts" "überwiegend" "verinnerlicht" worden wäre.
Im Gegenteil ist Antipathie gegenüber Israel eine weit verbreitete Grundhaltung in der deutschen Gesellschaft (quer durch sämtliche politischen Lager) und die falsche Meinung, Israel sei entstanden dadurch, dass räuberische Juden "den Palästinensern" ihr Land weggenommen haben, ist leider alles andere als ein Tabubruch im gegenwärtigen Diskurs.
Insofern kann die Inszenierung der InitiatorInnen als TabubrecherInnen – zusammen mit der groben Geschichtsklitterung der Ausstellung auf inhaltlicher Ebene –, verstanden werden als typisches Element eines modernen Antizionismus, der sich als widerständig und aufmüpfig inszeniert ("Man muss doch auch mal sagen dürfen..."), tatsächlich aber eben ein Ressentiment gegen den jüdischen Staat Israel bedient und schürt, das bedauerlicherweise tief verwurzelt und weit verbreitet ist.
Wir bitten Sie, Ihre Entscheidung zu überdenken, und davon zurückzutreten, dieser zweifelhaften, explizit israelfeindlichen Ausstellung auf dem Kirchentag ein Forum zu bieten. Wir hoffen auf Ihre Stellungnahme zu unserem Schreiben.
Mit freundlichen Grüßen,
gez. Bärbel Illi gez. Dr. Johann Jacoby
Das Fest der physischen und seelischen Freiheit
Rabbiner Yitshak Ehrenberg über Pessach
Die zentrale Mizwa der Sedernacht ist die »Haggada«, die Erzählung vom Auszug Israels aus Ägypten. Das Essen von Mazza und Bitterkraut sowie die anderen Bräuche des Pessachabends dienen der Veranschaulichung der Geschichte, damit wir sie besser empfinden und verstehen. Schließlich heißt es, dass der Mensch sich so sehen soll, als ob er selbst aus Ägypten auszieht (Haggada).
Die zentrale Mizwa der Sedernacht ist die »Haggada«, die Erzählung vom Auszug Israels aus Ägypten. Das Essen von Mazza und Bitterkraut sowie die anderen Bräuche des Pessachabends dienen der Veranschaulichung der Geschichte, damit wir sie besser empfinden und verstehen. Schließlich heißt es, dass der Mensch sich so sehen soll, als ob er selbst aus Ägypten auszieht (Haggada).
Die Mischna Pessachim sagt hinsichtlich der Ordnung der Haggada, dass man mit dem Unrühmlichen beginne und mit dem Lob ende. Das bedeutet, dass die Erzählung damit anfangen muss, wie schlimm es damals war, und damit abschließen soll, wie der Ewige uns erlöste und uns Gutes erwies. Der Ewige erlöste und rettete uns, führte uns aus Ägypten heraus und brachte uns in das Land Israel.
Im Talmud gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Raw und Schmuel darüber, mit welchem geschichtlichen Ereignis der Beginn der Erzählung zu setzen sei. Raw sagt, man beginne mit dem Auszug von unserem Vater Awraham aus dem Hause seines Vaters Terach, dem Götzendienerhause: »Zu Beginn waren unsere Väter Götzendiener. Terach, der Vater Awrahams…«. Schmuel dagegen sagt, man beginne mit: »Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten«. In der Haggada berücksichtigen wir beide Ansichten. Nach der Auffassung von Raw haben wir die Pflicht, auch für die geistige Freiheit, die geistige Erlösung, zu danken. Denn der Ewige führte Awraham aus dem Hause seines Vaters heraus und brachte ihn nahe zu sich. Die Meinung Schmuels hingegen scheint durch den Erzählbeginn mit der Erlösung aus der ägyptischen Sklaverei die physische Errettung zu pointieren.
Die Pessachhaggada erzählt den Auszug aus Ägypten
Wenn wir uns die Geschichte des Auszugs aus Ägypten genau ansehen, so finden wir in ihr sowohl eine physische und als auch eine psychische Erlösung. Wir wurden aus der ägyptischen Sklaverei, von unmenschlicher Arbeit, Bedrückungen und körperlichen Qualen befreit. »Und die Ägypter versklavten die Kinder Israel mit schwerer Fronarbeit« (Schmot 1:13). Nach langer Zeit in der Sklaverei zog das Volk Israel in die Freiheit. Der Sklave hat eine Sklavenmentalität. Er ist entrechtet; er darf nichts und kann nichts mehr selbst entscheiden. Alles wird für ihn entschieden. Die Versklavung einiger Generationen nahm von unseren Vorfahren die Fähigkeit, eigenständig Entscheidungen zu treffen, das Vermögen selbst zu wählen – den Willen zur freien Wahl. Ein Sklave ist wie ein Esel seines Herrn, man hat ihn daran gewöhnt, zu gehorchen und das zu tun, was man ihm sagt. Ein Sklave, sogar wenn er physisch aus der Knechtschaft befreit ist, hat nicht augenblicklich schon eine geistige Veränderung vollzogen. Sein Bewusstsein und sein Empfinden verändern sich nach seiner Befreiung nur allmählich. Sieben Wochen dauerte es, bis das Volk Israel aus dem Knechtsempfinden emporstieg, bis es frei war und würdig, aus freiem Willen die Tora zu empfangen.
Die Religion basiert auf der freien Wahl. Es heißt: »Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. So wähle das Leben…« (Dwarim 30:19). Seit dem Empfang der Tora, nach dem Auszug aus Ägypten, war es unserem Volk beschieden, die Fähigkeit wieder zu erlangen, aus der Freiheit des Willens heraus Entscheidungen zu treffen.
Jeder Jude hat eine eigene Meinung, wir haben keinen Herdentrieb. Niemand kann uns etwas aufzwingen und uns gegen unseren Willen und unsere Auffassung dauerhaft manipulieren. Hitler zog viele Millionen Menschen in seinen Bann, man folgte ihm wie blind. Bei uns kann das nicht passieren, wir haben mit dem Auszug aus Ägypten und der Gabe der Tora vom Ewigen die physische und psychische Freiheit als Geschenk bekommen. Deswegen sitzen wir am Sedertisch und danken dem Ewigen für die Erlösung aus Ägypten. Wir danken für die Errettung aus der Sklaverei und noch mehr für die geistige Befreiung, durch die das Volk Israel lebt und auf ewig besteht.
Mit dem Segen für ein koscheres und frohes Pessachfest für alle Mitglieder der Gemeinde,Rabbiner Yitshak Ehrenberg
Wir danken dem jüdischen Berlin herzlich für die Übernahmegenehmigung
Die Bedeutung des Pessach-Festes

Die Geschichte des Pessach ist allen bekannt ... wie das jüdische Volk in Ägypten versklavt war, wie Mosche uns aus der Gefangenschaft befreite und am Berg Sinai die Tora empfing ... wie wir nach vierzig Jahren in der Wüste ins Gelobte Land einzogen. Weniger bekannt ist jedoch, wie unsere Weisen die spirituelle Bedeutung dieser Ereignisse bewerten. Was bedeutet der Exodus heute für uns? Und was lehrt uns das "Fest der Befreiung" über die künftige Befreiung aller Menschen im messianischen Zeitalter? Die folgenden Seiten sind nur ein Auszug aus den Antworten der Rabbis.
Die Befreiung aus Mizrajim
Für die Juden ist "Ägypten" mehr als ein Ort auf der Landkarte - es ist ein seelischer Zustand. Der hebräische Name für Ägypten ist Mizrajim. Das Wort ist mit Majzorim verwandt, das "Grenzen" oder "Einschränkungen" bedeutet. Für das jüdische Volk bedeutet der Auszug aus Ägypten die Überwindung jener natürlichen Grenzen, die uns daran hindern, unser Potential voll zu nutzen.
Die innerste Essenz der Seele ist ein Funke G-ttlichkeit, unendlich und unbegrenzt. Doch die Seele lebt im Exil, in "Ägypten", das heißt, sie ist auf diese materielle Welt beschränkt. Das Ägypten eines Menschen zeigt sich in seinen egoistischen und niedrigen Wünschen oder im sklavischen Glauben an die Vernunft. Pessach ist eine Gelegenheit, unsere Grenzen zu überschreiten und das unbegrenzte spirituelle Potential in jedem Aspekt unseres Lebens zu erkennen.
@bold@Wahre Freiheit@/bold@
Als G-tt Mosche befahl, das jüdische Volk aus Ägypten zu führen, verkündete er auch, was er damit bezweckte: "Sie sollen G-tt auf diesem Berge dienen." Unsere Befreiung war erst vollkommen, als wir am Berg Sinai die Tora empfingen. G-ttes Tora und seine Gebote sind der Schlüssel zur wahren Freiheit; sie befreien uns nicht nur von der physischen Versklavung, sondern auch von allen einschränkenden Überzeugungen und Verhaltensweisen. Die Tora zeigt uns, wie wir die Fallen vermeiden, die das Leben uns stellt, und sie lehrt uns, wie wir aus dieser Welt einen Ort des Friedens, der Harmonie und des Glücks für alle Menschen machen.
Mazzot und Chamez
Pessach ist als "Fest der Mazzot" Bekannt. Uns ist geboten, am ersten Abend des Pessach Mazzot zu essen und uns während der gesamten acht Feiertage von Gesäuertem (Brot und alle gesäuerten Speisen) zu befreien. Dieses wichtige Gebot schenkt uns tiefe Einsicht in die wahre Natur unserer Befreiung.
Der Unterschied zwischen Brot aus Sauerteig und einer Mazza ist klar: Während Brot aufgeht, gehen Mazzot nicht auf. Unsere Rabbis erläutern, daß das "aufgeblasene" Chamez Arroganz und Hochmut symbolisiert, die flache, ungesäuerte Mazza dagegen äußerste Demut.
Demut ist der Anfang der Befreiung und die Grundlage des spirituellen Wachstums. Nur wer seine Fehler gegenüber einer höheren Weisheit bekennt, kann seine Grenzen überwinden. Am Pessach dürfen wir nicht einmal die winzigste Menge Chamez zu uns nehmen - und wir sollen den Stolz und den Egoismus aus unserem Herzen verbannen. Wenn wir die Pessachmazzen essen, nehmen wir Demut und Selbsttranszendenz in uns auf - die Essenz des Glaubens.
Das Teilen des Meeres
Am siebten Tag des Pessach gedenken wir der wunderbaren Teilung des Roten Meeres. Dies war der Höhepunkt des Auszugs aus Ägypten. Das jüdische Volk, dem die ägyptischen Krieger hart auf den Versen waren, stieg ins Meer, und G-tt "verwandelte das Meer in trockenes Land" und schuf Mauern aus Wasser zu beiden Seiten, so daß sein Volk das Meer durchqueren konnte. Als die Juden das andere Ufer erreicht hatten, brachen die Wasserwände zusammen, und die Ägypter ertranken.
Unsere Weisen erklären, daß die Teilung des Meeres eine weitere Phase unserer spirituellen Reise zur wahren Freiheit symbolisiert. So wie das Wasser des Meeres alles verdeckt und verbirgt, was in ihm ist, so verbirgt diese materielle Welt die g-ttliche Lebenskraft, der sie ihre Existenz verdankt. Die Verwandlung des Meeres in trockenes Land symbolisiert die Offenbarung einer verborgenen Wahrheit: Diese Welt ist nicht von G-tt getrennt, sondern mit ihm eins.
Wenn wir Ägypten verlassen, also unsere Grenzen überschritten und eine höhere Ebene erreicht haben, erleben wir ein unangenehmes Erwachen. Wir haben zwar Ägypten verlassen, aber es ist immer noch in uns, und wir haben immer noch die Wertvorstellungen der materiellen Welt im Kopf. Wir müssen danach streben, uns der Gegenwart G-ttes und ihres Einflusses auf unser Leben noch bewußter zu werden, bis das Meer sich teilt und wir vollkommen frei sind.
"Beende die Herrschaft des Bösen"
Während wir am Morgen vor Pessach das Chamez verbrennen, können wir ein besonderes Gebet sprechen, das den tiefen Sinn dieser Mizwa offenbart. Das ist in vielen Gemeinden Brauch.
Möge es Dein Wille sein ... daß Du, während ich das Chamez aus meinem Hause entferne, den Geist der Unreinheit von der Erde nimmst, unsere bösen Neigungen tilgst, uns ein Herz aus Fleisch schenkst, damit wir Dir in Wahrheit dienen können ... und die Herrschaft des Bösen auf der Welt beseitigst ... so wie Du damals Ägypten und seine Götzen ausgelöscht hast ... Amen, Sela.
"Ich will euch Wunder zeigen"
Nach den Worten des Propheten Micha erklärt G-tt: "So wie in den Tagen, als ihr Ägypten verließet, will ich euch Wunder zeigen." Der Exodus aus Ägypten ist der Vorläufer der endgültigen Erlösung, die der Moschiach bringt. Sklaverei und Leiden werden dann für immer vom Antlitz der Erde verbannt.
Warum, fragen unsere Rabbis, heißt es in diesem Vers "wie in den Tagen, als ihr Ägypten verließet", obwohl der Exodus doch an einem einzigen Tag stattfand?
Die Antwort lautet: Die wahre Befreiung ist ein längerer Prozeß. Die ersten Schritte aus "Ägypten" sind nur der Anfang. "In jeder Generation", sagen uns die Weisen, "und an jedem Tag sind wir verpflichtet, uns so zu verhalten, als seinen wir an eben diesem Tag aus Ägypten ausgezogen." Wir müssen also alle Lehren aus dem Pessach jeden Tag anwenden. Wir müssen uns von Hochmut befreien und demütig werden. Wir müssen unser G-ttesbewußtsein vertiefen, als ob das Rote Meer sich teile. Und wir müssen uns bemühen, unser Verhalten zu verbessern, wie es sich für ein Volk gehört, das am Berg Sinai die Tora empfangen hat. Jeder Schritt in Richtung Tora und Mizwot bringt uns den Offenbarungen des messianischen Zeitalters näher.
Die endgültige Erlösung
Der achte Tag des Pessach ist traditionell mit unserer glühenden Hoffnung auf die Ankunft des Moschiach verbunden. Die Haftara (Lesung aus den Propheten) für diesen Tag enthält Jesajas berühmte Prophezeiung über die messianische Ära: "Der Wolf wird beim Lamme liegen, der Leopard beim Kind ... Sie werden einander nichts antun und nichts zerstören ... denn die Erde wird mit dem Wissen G-ttes gefüllt sein, so wie das Wasser die Meere bedeckt."
Maimonides (der Rambam) bezeichnet den Glauben an den Moschiach als eine der dreizehn wichtigen Prinzipien unseres Glaubens. In seiner Sammlung jüdischer Gesetze erläutert er, daß der Moschiach ein Toragelehrter ist, der allen Juden zeigt, wie sie nach den Gesetzen der Tora leben können. Schließlich wird er den Heiligen Tempel zu Jerusalem aufbauen, die verstreuten Juden nach Israel führen und ein Zeitalter einleiten, in dem es weder Hunger noch Krieg, weder Eifersucht noch Streit gibt.
Zeichen der Hoffnung
In der chaotischen Welt von heute mag es manchem schwerfallen, an die bevorstehende Erlösung zu glauben. Aber die Geschichte des Pessach macht uns Mut. Damals kam die Erlösung rasch, "in einem Augenblick", und wir waren frei, obwohl unser Volk sich in den Händen des mächtigsten und grausamsten Volkes der Welt befand, aus dem noch nie ein Sklave entkommen war.
In jüngster Zeit waren wir Zeugen erstaunlicher Ereignisse (selbst weltliche Führer sprachen von "Wundern"): der Zusammenbruch des Kommunismus, der Golfkrieg, der Exodus von unterdrückten Juden nach Israel. Heute verringern viele Völker ihre Rüstung und suchen die Zusammenarbeit - sie "schmieden Schwerter zu Pflugscharen". Diese Entwicklung - die seit langem als Vorbote des messianischen Zeitalters gilt - stärkt unseren Glauben an die bevorstehende Ankunft des Moschiach. Der letzte Tag des Pessach ist eine einzigartige Gelegenheit, aus ganzem Herzen für den Moschiach zu beten: "Wiewohl er säumen mag, erwarte ich seine Ankunft jeden Tag." Es wird eine Zeit des Friedens und der Fülle für alle Menschen sein, und wir werden, wie Maimonides sagte, nicht mehr um unseren Lebensunterhalt kämpfen müssen. "Köstliche Speisen werden so reichlich vorhanden sein wie Staub, und wir werden Zeit für das Spirituelle haben, um unser Wissen über G-tt zu vertiefen."
Ein Vorgeschmack des Kommenden
Der Baal Schem Tow, der Gründer des Chassidismus, führte den Brauch ein, am letzten Tag des Pessach ein drittes Mahl mit Mazzen und Wein einzunehmen. Dieses Mahl heißt "Festmahl des Moschiach" und hat den Zweck, uns klarzumachen, daß die Ankunft des Moschiach unmittelbar bevorsteht. An diesem Tag, heißt es, kann man das Kommen des Moschiach geradezu spüren. "Siehe", heißt es im Buch der Lieder, "er steht hinter unserer Wand und schaut durch die Fenster und Spalten."
Jüdische Festtage: Pessach

- Fest des Auszugs aus Ägypten.
- Fest der Freiheit.
- Fest der Mazzot.
- Fest des Frühlings.
- 15.-22. Nissan.
Im Jahre 2013 fällt das Pessachfest auf d. 26.März - 2. April.
Quelle
Pessach ist das in der Tora meisterwähnte Fest. An ihm feiern die Juden den Auszug aus Ägypten, der das jüdische Volk vor dem Untergang bewahrte. Gerade erst in Entstehung begriffen - Pharao ist der erste, der die auf ägyptischem Boden sich mehrenden Nachkommen Jakobs als "Volk" wahrnimmt (Ex. 1,9) - wird es bereits zum Tode verurteilt: "Alle neugeborenen Söhne werfet in den Nil" (ebd. Vers 22). Durch ein sich in zehn gleichsam apokalyptisch anmutenden Naturkatastrophen (die 10 Plagen) manifestierendes göttliches Strafgericht wird die damalige Weltmacht Ägypten von Gott gezüchtigt und lässt die Juden aus dem Land ziehen (Ex. 7,19-12,51).
Das jüdische Volk erhält das Gebot, dieses Auszugs in aller Zukunft zu gedenken: "Und dieser Tag sei euch zum Andenken, und ihr sollt ihn feiern als Fest dem Ewigen; in allen Generationen sollt ihr ihn als ewige Satzung feiern" (Ex. 12,14).
Die Bedeutung des Festes
Die Bedeutung des Auszugs aus Ägypten für das Judentum
Der im Pessachfest für alle Generationen verewigte Auszug aus Ägypten ist der Grundstein, auf dem das ganze Judentum basiert. Der Jude soll seiner nicht nur an Pessach, sondern jeden Tag gedenken, wie es heißt: "… du sollst des Tages deines Auszugs aus Ägypten alle Tage deines Lebens gedenken" (Dt. 16,3).
Bei dem von den jüdischen Weisen formulierten Kidusch am Schabbat sowie an allen von der Tora vorgeschriebenen Feiertagen darf die "Erinnerung an den Auszug aus Ägypten" nicht fehlen. Denn ohne ihn gäbe es überhaupt keine jüdischen Feste, mit ihm steht und fällt das ganze Judentum. Er allein wäre Grund genug gewesen, zwischen Gott und dem jüdischen Volk ein ewiges Band zu knüpfen.
Sogar die oberste metaphysische Wahrheit des Judentums, ja der Religion überhaupt, der "grundlegendste Grundsatz und Stützpfeiler der Weisheit", das Wissen um die Existenz eines allmächtigen Gottes (*Maimonides, *Mischne Tora, Hilchot Jessode Hatora 1,1), ist für den Juden unauflösbar mit diesem Ereignis verbunden: "Ich bin der Ewige, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat", heißt es im ersten der zehn Gebote (Ex. 20,2). Der jüdische Glaube beruht mithin auf dem Wissen um Gottes Eingriff ins Schicksal des Volkes: dem Auszug aus Ägypten (Jehuda Halevi, Kusari, Kap. 1-2).
Volle Feiertage und "Halbfeiertage"
Das Pessachfest dauert eine Woche lang. Diese sieben Tage bezeichnen den Zeitraum vom Auszug aus Ägypten bis zur Überquerung des Schilfmeeres (roten Meers). Als volle Feiertage gelten jedoch nur der erste Tag - der Tag des Auszugs - und der letzte Tag - der Tag der Spaltung des Schilfmeeres. Dazwischen liegen die sog. Halbfeiertage ("Chol Hamoed"). An ihnen sind die meisten Werktätigkeiten zwar nicht verboten, sollen aber möglichst eingeschränkt werden (*Schulchan Aruch, Orach Chajim 530,1 und 539,1).
Das Chamez-Verbot
Das für dieses Fest wohl charakteristischste Gebot, das ihm seinen Stempel aufdrückt, ist das Verbot, an Pessach "Chamez" zu essen oder auch nur zu besitzen: "Gedenket dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid … kein 'Chamez' soll gegessen werden" (Ex. 13,3), ja "kein 'Chamez' soll bei dir zu sehen sein" (ebd. Vers 7). Chamez - meist als Gesäuertes übersetzt - bezeichnet sämtliche Speisen aus einer der fünf Getreidearten Weizen, Gerste, Dinkel, Hafer und Roggen, die einem Gärungsprozess ausgesetzt waren.
Dieser wird durch deren Kontakt mit Wasser bewirkt. Somit gelten alle aus Mehl (dieser fünf Getreidearten) und Wasser hergestellten Back- und Teigwaren, deren Teig Zeit hatte aufzugehen, d.h. zu gären, als Chamez. Das Chamez-Verbot ist sehr streng und gilt das ganze Fest über.
Symbolisch steht Chamez für den "bösen Trieb" im Menschen, für diejenigen Kräfte, die sein Ego, wie einen aufgehenden Teig, derart blähen, bis er sich selbst zum Maß aller Dinge wird (*Raschi zu *Talmud Berachot 17a) - insbesondere also für Überheblichkeit und Stolz: "Wenn einer überheblichen Mutes ist, so ist für Mich und ihn zusammen kein Platz auf der Welt, spricht Gott" (Talmud Sota 5a).
Jeder Teig, der zu lange sich selbst überlassen wird, geht nach einer Weile auf. Die Seele des Menschen ist wie der Teig. Wenn sie nicht geknetet wird, wenn man nicht ständig an ihr arbeitet, so bläht sie sich auf. Wo dem guten Trieb nicht Eingang verschafft wird, "schwillt" der böse Trieb. Überheblich prahlte Ägyptens Pharao: "Mir gehört mein Nil, ich selbst habe mich erschaffen" (Ezekiel 29,3) und: "Wer überhaupt ist Gott, dass ich auf seine Stimme höre" (Ex. 5,2).
Am Vorabend des 14. Nissan geht jeder jüdische Hausvater mit einer Kerze umher und leuchtet in alle Ecken und Winkel hinein, um auch die letzten Brotkrümelchen, eventuelle allerletzte Reste von Chamez in seiner Wohnung aufzuspüren (*Schulchan Aruch, Orach Chajim 431,1). So sollte er auch die Winkel seiner Seele durchleuchten.
Diese letzten Reste von Chamez sollen dann am nächsten Morgen, dem Vortag des Pessachfestes, verbrannt werden (ebd. 446,1 und *Rema z.St.). Dabei pflegen manche folgendes zu sprechen: "Möge es Dein Wille sein, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, dass Du den bösen Trieb aus unserem Inneren vertilgst, so wie ich jetzt den Chamez vertilge. Ich erkläre ihn für null und nichtig wie den Staub der Erde". Gerade jetzt, am Jahrestag des Beginns der Gottesherrschaft über das jüdische Volk soll die Bereitschaft bekundet werden, sich restlos Gottes Führung zu fügen - wie damals, beim Auszug aus Ägypten.
Die anderen Gebote des Pessachfestes sind keine Verbote (wie das Chamez-Verbot) sondern Gebote und erstrecken sich auch nicht auf das ganze Fest, sondern nur auf die erste Pessachnacht (in der Diaspora die ersten beiden Pessachnächte), den sog. Sederabend. Das zu Tempelzeiten veranstaltete Pessachopfer musste sogar schon am Nachmittag zuvor dargebracht werden.
Das Pessachopfer
"Am vierzehnten Tage dieses Monats ( Nissan ) gegen Abend sollt ihr es (das Pessachopfer) darbringen" (Num. 9,3), "und ihr sollt es einhalten als Satzung für dich und deine Söhne auf ewig" (Ex. 12,24). Als der Tempel noch stand, wurde am Vorabend des Pessachfestes ein Lamm als Pessachopfer dargebracht. Dessen "Opfercharakter" bestand u.a. darin, dass die anschließend in jedem jüdischen Haus stattfindende Opfermahlzeit mit bestimmten Vorschriften verbunden war. Erst durch sie gewann ein ursprünglich rein physisches Bedürfnis (Essen) einen zusätzlichen geistigen Wert.
Dieses an Pessach dargebrachte Lamm sollte allen nachfolgenden Generationen das ursprüngliche Pessachopfer vergegenwärtigen, das die Juden kurz vor ihrem Auszug aus Ägypten dargebracht haben. Damit stellten sie nicht nur ihre Freiheit von jeglicher Menschenknechtschaft unter Beweis, sondern auch ihre Reife und Bereitschaft für die ihnen von Gott zugedachte Freiheit: Die Freiheit der Gottesknechtschaft.
Dem Pessachopfer verdankt das Pessachfest auch seinen Namen. "Was hat 'Pessach' zu bedeuten?", fragt die Haggada im Hinblick auf dieses Opfer und antwortet: "dass Gott über die Häuser unserer Väter in Ägypten hinwegschritt (Hebr. 'passach') … als er die Ägypter schlug" (vgl. *Mischna Pessachim 10,5 und Ex. 12,27).
Dieses Gebot kann heute nicht erfüllt werden, denn seit der Zerstörung des Tempels können keine Opfer mehr dargebracht werden. Ein gebratener Knochen auf der Seder-Schüssel erinnert an das Pessachopfer.
Der Sederabend
Jüdische Feiertage fangen am Abend, bei Anbruch der Finsternis an. Der erste Abend des Pessachfestes (in der Diaspora die ersten zwei Abende) heißt Sederabend. Dieser wird im Rahmen einer familiären, den Charakter einer Tischzeremonie tragenden Festmahlzeit begangen. "Seder" heißt "Ordnung", denn der Sederabend zeichnet sich durch eine besondere Ordnung aus: den "Seder-Pessach".
Dieser besteht aus einer bestimmten Reihenfolge von Handlungen, die erst seit dem 12. Jh. in der gesamten Diaspora einheitlich war. Seit dieser Zeit hat sich wohl auch die Seder-Schüssel eingebürgert, auf der bestimmte symbolische Gerichte ("Simanim") angeordnet sind (*Schulchan Aruch, Orach Chajim 473,4). Diese kommen im Laufe des Seder-Pessach "zum Einsatz". Im Zentrum der Seder-Schüssel liegen drei Mazzot.
Mazza
Am Sederabend soll man Mazza (sog. ungesäuertes Brot) essen. Denn das gewöhnliche Brot ist "Chamez" und darf daher an Pessach nicht gegessen werden. Brot und Mazza sind von ihrer Zusammensetzung her identisch, denn als Mazza gilt nur, was gerade aus dem Teig hergestellt wurde, welcher, wenn gegoren, zu Chamez wird. Der einzige Unterschied zwischen Chamez und Mazza liegt mithin im Gärungsprozess: bei Chamez lässt man ihn gewähren, bei der Mazza wird er durch sofortiges Backen unterbunden.
Während man an allen anderen Tagen des Pessachfestes zwar kein Chamez essen darf, jedoch auch nicht verpflichtet ist Mazzot zu essen, ist das Essen von Mazzot am ersten Pessachabend, dem Sederabend, ein Toragebot: "Am vierzehnten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr Mazzot essen ..." (Ex. 12,18).
Die Mazza weist einen bemerkenswerten Doppelcharakter auf. Zum einen heißt sie das "'Brot der Armut' ('Lechem Oni'), das unsere Väter in Ägypten gegessen haben" (Haggada), zum anderen gilt sie als das Brot der Erlösung, mit dem die Juden aus Ägypten zogen. Diese doppelte Funktion der Mazza kann vielleicht als ein Hinweis darauf angesehen werden, dass die Güter dieser Welt keinen ihnen inherenten absoluten Wert haben, der ihnen immer und überall zukommt. Vielmehr sind sie in einen Schicksalskontext eingebunden, der ihnen ihren Wert verleiht. Ein- und dieselbe Mazza kann daher einmal als Brot der Armut, einmal als Brot der Erlösung gelten.
Die Mazza weist noch einen weiteren Doppelaspekt auf. "Sieben Tage lang sollt ihr nur Mazzot essen …" (ebd. Vers 15), heißt es noch vor dem Auszug aus Ägypten. Hier wird uns die Mazza als von vornherein geboten vorgestellt. In der Haggada hingegen begegnet sie uns als eine eilig improvisierte Wegzehrung.
Auf die Frage: "Was hat diese Mazza, die wir da essen, für eine Bedeutung?", heißt es dort unter Berufung auf einen anderen Toravers: "Sie ist ein Hinweis darauf, dass der Teig unserer Väter keine Zeit hatte aufzugehen … 'da sie aus Ägypten getrieben wurden und sich nicht aufhalten konnten und sich daher auch keine Wegzehrung bereitet hatten' (Ex. 12,39)".
Vielleicht ist dieses Paradox ein Hinweis darauf, dass die in unseren Augen oftmals den Stempel der Nachträglichkeit tragenden Geschehnisse letztlich von vornherein so vorgesehen waren.
Maror
Zu den auf der Seder-Schüssel angeordneten Speisen, die die Mahlzeit nach geistigen Gesichtspunkten gestalten, gehört der Maror, das Bitterkraut. Als Maror, Bitterkraut, kann im Grunde jede bittere Pflanze dienen. "Was hat dieser Maror, den wir da essen, für eine Bedeutung", fragt die Haggada, um sogleich zu antworten: "Er erinnert uns daran, wie die Ägypter unseren Vätern das Leben bitter machten, wie es heißt: 'Sie machten ihr Leben bitter mit harter Arbeit …'". Die Erinnerung an die eigenen Leiden soll läuternd wirken. Nicht das bloß passive Leiden selbst, wohl aber die inneren Kräfte, die dadurch erst ans Licht traten, machten die Juden reif für ihre Sendung (Carlebach, 1931).
Mit der Erinnerung an die eigene Bitternis ist das Gebot verbunden, auch dem Leiden des anderen, des "Fremden", sein Herz aufzuschließen: "Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde wart ihr im Lande Ägypten" (Lev. 19,34).
Haggada - "Du sollst deinem Kind erzählen …" (Ex. 13,8)
Der Sederabend ist ganz und gar um die Haggada, die Erzählung vom Auszug aus Ägypten, aufgebaut. Diese richtet sich ausdrücklich an die Kinder, an die nächste Generation also: "Wenn dein Kind dich dann später einmal fragen sollte: 'Was hat es auf sich mit diesen Satzungen, Geboten und Rechtsverordnungen, die euch der Ewige, unser Gott, anbefohlen?', so sprich zu ihm: 'Sklaven waren wir dem Pharao in Ägypten, doch der Ewige führte uns heraus aus Ägypten mit starker Hand'" (Dt. 6,20-21). Die ausdrückliche Bezugnahme auf die Kinder macht die Haggada besonders im Hinblick auf das in ihr angewandte pädagogische Rüstzeug interessant.
Die zentralen Passagen der Pessach-Haggada werden schon in der *Mischna aufgeführt (Pessachim, Kap. 10), so dass die Haggada, obwohl ursprünglich wohl frei erzählt, bereits früh in eine relativ feste Form gegossen wurde. In dieser Form, zuzüglich einiger Zusätze aus dem Mittelalter, ist sie uns bis heute erhalten geblieben.
Das Leitmotiv der in der Haggada angewandten Pädagogik ist die Stimulierung kindlicher Neugier. Alles ist anders an diesem Abend, mit Absicht anders.
Das Kind wird durch eine Reihe im Rahmen des Sederabends vorzunehmender Handlungen zum Fragen angeregt. Wie von selbst soll sich die berühmte vierfache Frage der Haggada dem Kind aufdrängen:
"Wieso unterscheidet sich diese Nacht derart von allen anderen Nächten?
In allen anderen Nächten essen wir sowohl Chamez als auch Mazza, in dieser Nacht nur Mazza.
In allen anderen Nächten essen wir sonstiges Gemüse, in dieser Nacht gerade Bitterkraut.
In allen anderen Nächten tunken wir (das Gemüse) nicht ein einziges Mal ein, diese Nacht jedoch gleich zweimal.
In allen anderen Nächten essen wir aufrecht sitzend oder angelehnt, in dieser Nacht jedoch nur angelehnt".
Das "Anlehnen" gilt beispielsweise als Hinweis auf die beim Auszug aus Ägypten gewonnene Freiheit. Nur freie Menschen sitzen angelehnt, Sklaven hingegen müssen auch mitten im Essen immerzu abrufbereit sein, was sich auf ihre Körperhaltung auswirkt.
Ein anderer pädagogischer Grundsatz, der in der Haggada zum Tragen kommt, stammt von König Salomon: "Erziehe den Jugendlichen gemäß seiner Art …", lautet die von ihm geprägte Erziehungsformel (Sprüche 22,6).
Nur dann nämlich, wenn die Erziehung der jeweiligen individuellen Persönlichkeit des Kindes gerecht zu werden vermag, kann sie auf nachhaltigen Erfolg hoffen: " … wenn er dann alt wird, weicht er nicht davon" (ebd.). Salomons Erziehungsdevise findet in der Haggada, der pädagogisch aufgebauten Erzählung vom Auszug aus Ägypten, ihre praktische Anwendung: "Von vier Kindern spricht die Tora: dem scharfsinnigen, dem rebellischen, dem gutmütig-naiven und dem unartikulierten" (Haggada).
Diesen vier Grundtypen soll man die Erzählung aus Ägypten daher auch auf jeweils verschiedene Weise präsentieren. Während sich die in der Haggada in der Folge aufgeführten Antworten an das scharfsinnige und das gutmütig-naive Kind einfach an deren intellektuellem Niveau orientieren, werden die provokativen Fragen des rebellischen Kindes bezeichnenderweise ebenso provokativ beantwortet. Dem unartikulierten Kind schließlich, dessen Wissbegier nicht einmal durch die zahlreichen Handlungen des Sederabends angeregt wurde, muß man zuvorkommen. Man erzählt ihm die Geschichte über den Auszug aus Ägypten in ihm verständlichen Worten auch unaufgefordert.
Ein weiteres Erziehungsprinzip der Haggada betrifft das Verhältnis zwischen den Generationen. Nicht der Generationenkonflikt, sondern der Appell an die Solidarität der Generationen soll das kindliche Gemüt prägen: "In jeder Generation soll man sich betrachten, als ob man selbst aus Ägypten gezogen wäre" (Mischna Pessachim 10,5). Die persönliche Identifizierung mit den aus Ägypten ziehenden Vorfahren ist der Haggada ein unschätzbarer Wert: "Die Fähigkeit, sich in die Erzählung vom Auszug aus Ägypten zu vertiefen, ist ein Maßstab für geistige Größe" (Haggada, nach der Interpretation des Naziw zu Ex. 6,22).
Die vier Becher der Erlösung
Vier Becher Wein oder Traubensaft soll man im Verlaufe des Seder-Abends trinken. Sie erinnern an die vier Stufen der Erlösung, in denen sich nach Zeugnis der Tora (Ex. 6,6-7) der Auszug aus Ägypten vollzog (Jer. Talmud Pessachim, Anfang Kap. 10):
1. "Ich werde euch hinausführen aus der Lastknechtschaft Ägyptens
2. und euch erretten aus ihrer Fron
3. und Ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm
4. ...und werde euch Mir zum Volke nehmen und euch zum Gotte werden".
Die erste Stufe bezeichnet die Erlösung aus der drückenden Lastknechtschaft, das Ende der akuten physischen und geistigen Pein.
Die zweite Stufe bezeichnet die Aussetzung der Fron, die Beendigung des Herrschaftsverhältnisses, das die Ägypter zu Herren und die Juden zu Knechten machte.
Die dritte Stufe ist die Aufhebung des Fremdenstatus. Nicht als hilflose Fremde, vielmehr als Gottes "erstgeborener Sohn" (Ex. 4,22) ziehen die Juden aus Ägypten.
Die vierte Stufe bezeichnet die Vereinigung des befreiten Volkes mit Gott am Berg Sinai (nach S.R. Hirsch zu Ex. 6,6-7).
Das Fest des Frühlings
Pessach muss immer im Frühling stattfinden: "Halte den Monat der Ährenreife ein, und bringe dann das Pessachopfer dar, denn im Monat der Ährenreife führte dich der Ewige, dein Gott aus Ägypten" (Dt. 16,1). Die Ährenreife fällt in die Frühlingszeit. Die unbedingte Verbindung des Pessachfestes, dessen Datum (15.-22. Nissan) nach dem Mondzyklus berechnet wird, an eine Jahreszeit, d.h. an den Sonnenzyklus, ergab die Notwendigkeit, einen Kalender zu schaffen, der sowohl dem Mond- als auch dem Sonnenzyklus gerecht wird: den hebräischen Kalender.
Nur durch diesen Lunisolarkalender kann dem Pessachfest, wie den anderen jüdischen Festen, auch dessen landwirtschaftliche Komponente erhalten bleiben: mit ihm setzt die Erntezeit ein. Darüberhinaus kann eine mit einer Jahreszeit verbundene Erscheinung, ein Naturereignis also, auch ein passendes Sinnbild für einen gesellschaftlichen bzw. geschichtlichen Vorgang bilden (wie z.B. ein "frostiger Empfang" oder ein "politisches Tauwetter"). Im Hinblick auf das Pessachfest fallen der Aufbruch des jüdischen Volkes aus dem "ägyptischen Winterschlaf" und insbesondere die alljährliche Erinnerung daran wohl nicht zufällig mit dem Frühlingserwachen zusammen. Die Natur wird hierbei als im Dienst der Geschichte stehend betrachtet (S.R. Hirsch, Gesammelte Schriften, Band 1 und 5, zu Nissan).
Das Omer-Zählen
Am Ausgang des ersten Pessach-Feiertages wurde unter feierlicher Beteiligung des Volkes eine Garbe (hebr. "Omer") Gerste geerntet und am nächsten Morgen als Erstlingsopfer im Jerusalemer Tempel dargebracht. Von dieser ersten Gerstenernte an, d.h. ab dem Ausgang des ersten Pessach-Feiertages, findet das sog. Omer-Zählen statt. Denn genau sieben Wochen, 49 Tage nach dem Darbringen des "Omer", soll Schawuot, das Fest der Übergabe der Tora, begangen werden. Bis dahin zählen die Juden die Tage. Das Omer-Zählen findet auch heute noch im Rahmen des Abendgebetes statt. Ihm wird tiefe Bedeutung zugeschrieben: Die an Pessach erlangte physische Freiheit wird an Schawuot durch die geistige Freiheit vervollständigt. Letztere wird dem Menschen erst durch die Tora gewährt.
15. - 22. Nissan: Pessach

von Nurit Schaller
Pessach erinnert an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei und somit an die Geburt des jüdischen Volkes. Es wird acht Tage (in Israel sieben) gefeiert, wobei die ersten und die letzten zwei Feiertage, im Sinne von Yom Tow, die mittleren vier Halbfeiertage, Chol HaMo'ed, sind.
"The purpose of the Exodus was to enable God to give us the Torah at Mount Sinai and allow us to inherit Eretz Israel as free man." (R. Israel Meir Lau)
"Dreimal feiert mir ein Fest im Jahre. Das Fest der ungesäuerten Brote beobachte: sieben Tage iß ungesäuerte Brote, so wie ich dir geboten, zur Zeit des Monats der Ährenreife; denn in dem selben bist du aus Mizrajim gezogen; und man erscheine nicht leer von meinem Angesichte. [...]" (Ex. 23,14-15)
* Die Pessach-Geschichte (siehe Exodus, Kapitel 1 - 15)
* Namen und Bedeutung
* Erklärungen
* Kosher für Pessach: Tips und Produktinformationen
Namen und Bedeutung:
# Chag HaMazzot - Das Fest der ungesäuerten Brote
Mazza, das ungesäuerte Brot, erinnert an den hastigen Aufbruch aus Ägypten, als keine Zeit mehr blieb, um den Brotteig gären zu lassen. "Und sie buken den Teig, den sie mitbrachten aus Mizrajim, zu ungesäuerten Kuchen, denn er hatte nicht gesäuert; weil sie getrieben wurden aus Mizrajim, [...]" (Ex.12,39)
Die Tora verbietet den Genuß von Chametz für spätere Generationen aus zwei Gründen (nach R. I. M. Lau):
1. Um uns an das Wunder zu erinnern, das unseren Vorvätern geschah, als Gott sie aus Ägypten befreite.
2. Um zukünfige Generationen daran zu erinnern, wie stark deren Glauben an Gott war: denn obwohl sie in keinster Weise auf den drastischen Wechsel von der Knechtschaft zur Freiheit vorbereitet waren, gaben sie ihr (Über-)Leben in Gottes Hand und zogen aus in die Ungewißheit der Wüste, wie der Ewige es ihnen befohlen hatte.
Sowohl der Genuß als auch der Besitz von Chametz jeglicher Art ist während dieser acht Tage strengstens untersagt, was u. a. in Ex. 12,19 deutlich gemacht wird: "Sieben Tage soll Sauerteig nicht gefunden werden in euren Häusern; denn so Jemand Säuerndes ißt, so soll dieselbige Person ausgerottet werden aus der Gemeinde Jisrael's [...]." Demzufolge muß der gesamte Haushalt von Gesäuertem gereinigt (Suchen nach Chametz), dasselbe entfernt (Verkauf und Verbrennen von Chametz) und auch das komplette Geschirr entweder gewechselt oder gekaschert werden (Koscher für Pessach).
Link zum Thema: www.torah.org/advanced/jerusalemviews/pesach.html
# Pessach - Das Fest der Überschreitung
"In der letzten Nacht, noch auf dem Boden Ägyptens, feierten die Israeliten das Fest der Überschreitung, für alle Zeiten "Pessach" genannt. In dieser erhabenen und erleuchteten Nacht überschritt Gott die "bezeichneten Häuser" der Israeliten, als er die zehnte und letzte Plage (Tod der Erstgeborenen, Anm. von T. S.) über die Ägypter brachte." (Ex. 12,13)(N. Bar-Giora - Bamberger) Nach R. Chaim Halevy Donin bezieht es sich auf das Opfer des Pessach-Lammes, dessen Blut die Israeliten als Kennung an ihre Türpfosten gestrichen hatten. "Und das Blut sei euch zum Zeichen an den Häusern, in welchem ihr seid, und ich werde das Blut sehen, und werde über euch wegschreiten, und es wird euch keine verderbliche Plage treffen, [...]" (Ex.12,13)
"Warum nennen wir das Fest "Pessachfest" und nicht "Chag HaMazzot" - das Fest der Mazzot - wie es in der Tora genannt wird? Ein Vers in "Schir HaSchirim" (das Hohelied, Anm. von T. S.) gibt uns hierzu in einer Andeutung die Antwort: "Ani LeDodi WeDodi Li" - Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Die Gemeinschaft Israel ist voll und ganz Gott zugewandt, und auch der Heilige, gelobt sei Er, wendet sich dem Volke in Liebe zu. Gott gibt in Seiner Tora dem Feste den Namen "Chag HaMazzot", weil Er damit ein Lob für Israel aussprechen will, weil es Ihm in die Wüste gefolgt war, ohne zu warten, bis der Tag aufging, ohne zu fragen, wohin es geführt werde. Israel jedoch nennt das Fest "Chag HaPessach", um den Heiligen, gelobt sei Er, damit zu loben und zu betonen, mit welch großer Liebe zu uns Er unsere Häuser überschritten hat, als Er Ägypten schlug, unsere Häuser jedoch verschont hatte." (R. Levi Jizchak aus Berdischew)
# Chag HaAviv - Das Frühlingsfest
"Heute zieht ihr aus im Monat der Ährenreife (im Hebräischen: be-chodesch ha-aviv = im Frühlingsmonat; Ex. 13,4)." Raschi leitet Aviv, Frühling, von Av ab, was im eigentlichen Sinne Vater bedeutet, aber im übertragenen auch Haupt, Anfang. Demnach ist es der Monat, in dem die Natur zu neuem Leben erwacht. Nissan ist der erste Monat und Pessach das erste Fest. Es ist das erste der drei Wallfahrsfeste (das zweite ist Schawu'ot, das dritte Sukkot), wo die erste Ernte, nämlich die Gerstenernte, eingeholt und als Omer geopfert wurde.
# Seman Cherutenu - Zeit unserer Befreiung
Was ist der zentrale Punkt dieses Festes? Die Befreiung aus der Sklaverei und die Errungenschaft der Freiheit! "This event became the focal point of Jewish history because it crystallized the Jewish national identity and marked the birth of the Jews as a free people, and also because the lessons gained from the experience of Egyptian slavery and redemption provided a powerful basis for many important concepts of Jewish faith and ethic." (R. Chaim Halevy Donin) In den letzten Jahrhunderten des Exils und der Unterdrückung hat Pessach eine weitere Dimension bekommen: "In jeder Generation soll der Mensch sich betrachten, als sei er selbst aus Ägypten gezogen. So heißt es (2. B. M. 13,8): An jenem Tag erzähle deinem Sohn: Dafür hat Gott es für mich getan, als ich aus Ägypten gezogen bin. Nicht allein unsere Väter hat der Heilige, gelobt sei Er, erlöst, auch uns hat Er mit ihnen zusammen erlöst, [...]." (Die Basler Hagadda) Es ist somit nicht nur eine Erlösung in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt und in der Zukunft. Die Befreiung und die Freiheit wird jedem einzelnen in jeder Generation aufs Neue ermöglicht, sie ist nicht ein Faktum der Vergangenheit, sondern ein lebendiger Prozeß.
Der Begriff "Freiheit" wird hier nicht einfach als "Freiheit von", also der Abwesenheit von Sklaverei, verstanden, sondern als "Freiheit zu", sprich der Möglichkeit der freien Willens - und Persönlichkeitsentfaltung. Der freie Mensch handelt frei nach seinem Willen und trägt die Verantwortung für seine Taten. "Freedom is most often perceived as the absence of slavery - just as slavery can be defined as the absence of freedom. But in reality, the absence of slavery does not itself create a condition of freedom. Slavery is a condition wherin one is forever forced to act according to the will of another. Freedom is the ability of man to act and express selfhood." (R. Adin (Steinsaltz) Even-Yisroel) "Freiheit zu" bedeutet aber auch, frei zu sein für Gott.
Gedanken zum Thema "Freiheit" siehe auch unter:
* www.farbrengen.com
* www.hagalil.com/judentum/feiertage/pessach/magoneth.htm
Mehr Information zu Pessach:
* www.torah.org/learning/yomtov/pesach
* www.chabad.org
* www.chabad.com
* www.farbrengen.com
* www.hagalil.com/judentum/feiertage/pessach
Grußkarten zu Pessach:
* www.bluemountain.com/eng/passover
* www.egreetings.com
Chametz:
1. Chametz ist jegliche der folgenden Getreidesorten: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel, wenn sie mindestens achtzehn Minuten in Kontakt mit Wasser waren, d. h. wenn man annehmen kann, daß der Gärungsprozeß schon eingesetzt hat.
2. Chametz ist jegliches Nahrungsmittel (also auch Getränke), die diese fünf obengenannten Getreidesorten beinhalten. Außer Mazza, wobei in diesem Falle strenge Backvorschriften vorliegen, um den Gärungsprozeß zu verhindern. Werden die Vorschriften dafür nicht eingehalten, ist Mazza ebenfalls Chametz (und somit gar nicht Mazza).
3. Reis, Mais, Erdnüsse und Hülsenfrüchte sind Kitni'ot.
Folgende Nahrungsmittel sind also nicht Chametz (außer sie werden mit Chametz vermengt):
1. Fleisch, Geflügel, Fisch
2. Obst
3. Gemüse (bei aschkenazischer Tradition siehe oben)
4. Gewürze
5. Milchprodukte
Siehe auch: Koscher für Pessach!
Mazza:
Mazza ist ungesäuertes Brot, fast so dünn wie eine Oblate, hergestellt aus dem Mehl von einer der fünf Getreidearten : Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Dinkel. Der gesamte Backprozeß von der Zeit an, wo das Mehl in Berührung mit Wasser kommt, darf daher nicht mehr als maximal achtzehn Minuten betragen. Ist Mazza einmal gebacken, kann der Gärungsprozeß völlig ausgeschlossen werden. Daher werden von fertigen Mazzot verschiedene andere Mazza-Produkte hergestellt wie z.B. Mazza-Mehl.
Mazza Schmura:
schmura kommt vom Hebräischen schamur bewahrt, aufbewahrt, ist also von speziell aufbewahrtem Mehl d.h. es wurde darauf geachtet, daß das dafür verwendete Mehl nicht in Kontakt mit Wasser kommt, also nicht gären kann.
© Nurit Schaller
Netanyahu trifft Kerry und Hague
Ministerpräsident Binyamin Netanyahu hat am Donnerstag in Jerusalem US-Außenminister John Kerry empfangen.
Bei dem Treffen sagte Netanyahu:
„Sie sind ein alter persönlicher Freund und ein langjähriger Freund Israels, und diese Freundschaft wurde während des historischen Besuchs von Präsident Obama hier im März unter Beweis gestellt. Erneut wurde sie gestern in einer außergewöhnlichen Resolution des US-Senats unter Beweis gestellt, an der Seite Israels gegen das iranische Nuklearprogramm zu stehen.

Außenminister Kerry und Ministerpräsident Netanyahu (Foto: GPO)
Ich möchte dem Komitee für Auswärtige Angelegenheiten des Senats dafür danken, dass es die Sanktionen erhöht hat. Wir werden also über den Iran sprechen; wir werden das schreckliche Blutbad und die Instabilität in Syrien besprechen; doch mehr als alles andere werden wir darüber sprechen, was wir tun möchten, um die Friedensgespräche mit den Palästinensern wieder aufzunehmen. Sie arbeiten daran sehr intensiv. Wir arbeiten gemeinsam daran. Wir wollen es, Sie wollen es. Ich hoffe, die Palästinenser wollen es auch, und wir können aus einem ganz einfachen Grund Erfolg dabei haben: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“
Außenminister Kerry sagte: „Es hat einige sehr ernsthafte Treffen gegeben, viele sehr ernsthafte Diskussionen. Wir arbeiten mit dem Ministerpräsidenten, mit Ministerin Tzipi Livni, mit dem Militär. […] Ich möchte nochmals wiederholen, dass die USA seit jeher und auch heute der Sicherheit des Staates Israel verpflichtet sind. […]
Ich kenne diese Region gut genug, um zu wissen, dass einige skeptisch sind. […] Jahre der bitteren Enttäuschungen liegen hinter uns. Wir hoffen, dass wir durch methodisches, vorsichtiges, geduldiges, aber auch gründliches und beharrliches Vorgehen einen Weg finden können, der Menschen vielleicht überraschen wird, doch ganz sicher die Möglichkeiten des Friedens ausschöpft.“
Zuvor war Netanyahu bereits mit dem britischen Außenminister William Hague zusammengetroffen.

Außenminister Hague und Ministerpräsident Netanyahu (Foto: GPO)
Bei dem Treffen äußerte sich der Ministerpräsident zunächst zu dem Anschlag auf einen britischen Soldaten in London. Er sagte:
„Lassen Sie mich meine Solidarität und die Solidarität Israels mit der Regierung und dem britischen Volk angesichts des schrecklichen Terroranschlags […] aussprechen. Wir senden der Familie und dem britischen Volk unser Beileid.
Wir haben solche Schrecken hier selbst erlebt und haben daher großes Mitgefühl. Wir beide stehen vor diesem Kampf gegen die Brutalität und diesen Terrorismus in unseren eigenen Ländern und auf der ganzen Welt.“
Hague dankte Netanyahu und sagte: „Israel ist ein wichtiger Freund und strategischer Partner für Großbritannien, und wie Sie wissen, sind wir der Sicherheit Israels sehr verpflichtet. Ich freue mich darauf, mit dem Ministerpräsidenten unsere Kooperation auf diesem Gebiet zu diskutieren, einschließlich der großen Sorgen, die wir in Bezug auf das Atomprogramm des Iran haben. Wir verfolgen den Ansatz von Sanktionen und Verhandlungen, doch niemand sollte an unserer Entschlossenheit in diesen Angelegenheiten zweifeln.“
(Amt des Ministerpräsidenten, 23.05.13)
Peres empfängt Sarkozy
Präsident Shimon Peres hat am Donnerstag in seinem Amtssitz in Jerusalem den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy zu einem Arbeitstreffen empfangen.

Sarkozy und Präsident Peres (Foto: GPO)
Peres dankte zunächst Sarkozy für sein klares Bekenntnis zu Israel während seiner Amtszeit als Präsident Frankreichs.
Dann äußerte Peres sich zur Eskalation an der Grenze zu Syrien. Peres erklärte: „Es gibt zu viele Feuer im Nahen Osten. Zuallererst müssen wir die Höhe der Flammen reduzieren.“ Peres erläuterte, er sei sich sicher, sowohl Israel als auch Syrien hätten keinerlei Interesse an einem bewaffneten Konflikt.
Nicolas Sarkozy hält sich zurzeit in Israel auf, um einen Ehrendoktortitel des Netanya-Colleges entgegenzunehmen.
(Präsidialamt, 23.05.13)
Syrien versuchte die Wasserversorgung der Stadt Haifa anzugreifen
Angriff mißlang. Vater der israelischen Cyberverteidigung enthüllt
in Beer Sheva
von Anat Zetnik

Itzchak Ben Israel
Es ist eine Art Martinee, nennt sich "Kultur- Shabbat" und fand in Beer
Sheva statt. Manchmal liefern die kulturellen Vormittage echte Knüller.
So ein Knüller wurde am Samstag Vormittag in der Negevstadt in den
Umlauf gebracht.
Itzchak Ben Israel ist der Vater der Cyberdefence in Israel.
Nach Angaben des Cyberprofessors versuchte vor etwa zwei Wochen
die "Cybereinheit" der syrischen Armee einen Angriff auf die Wasserversorgung der nordisraelischen Metrople Haifa.

Der Angriff soll ein Racheakt für zwei Angriffe der Luftwaffe Israels auf syrische Waffenlieferungen an die Terrorgangs der Hizbollah im Libanon. Israel hatte als eine der erste Staaten der Welt umfangreiche
Ressourcen in die Verteidigung computergesteuerter Systeme gesteckt.
Dies scheint notwendig wie Professor Ben Israel bestätigte. Überdies gab der Cyberexperte an, der Iran stünde kurz vor der Fertigstellung der Mullah-Atombombe. Amerikanisch- Israelische
Angriffsdrohungen würden eine Verzögerung bewirken, so Ben Israel.
Vom Partygirl zum Propaganda-Pinup der Mullahs
Eine Australische Laufbahn mit Ecken und Kanten
von Ayelet Himmelfarb

Edwina Storie war ein leichtbekleidetes Model und bekanntes Gesicht der Partyszene in New South Wales bevor die Moral und die Finanzmittel der Mullahs eine neue Laufbahn eröffneten.
Press TV ist das offizielle elektronische Schaufenster der islamischen Republik Iran. Wie die Arbeitgeber der australischen Nachwuchshoffnung auf die Enthüllung eines australischen Tabliods reagieren ist bis zur Stunde nicht bekannt..
Verborgenes und Wahrnehmbares
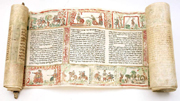
Rabbiner Yitshak Ehrenberg über die Megillat Esther und Purim
»We Anochi Haster Astir Panaj« – Aber ich… werde… mein Angesicht verbergen« (Dwarim 31:18).
Die Estherrolle ist das einzige Buch des Tanach, in dem der Name des Ewigen nicht erwähnt wird. Alle Schriften der hebräischen Bibel sind heilig, warum also nennt man den Namen G’ttes in der Estherrolle nicht? Die Megillat Esther will aufzeigen, dass der Ewige in jedem Fall seines Verborgenseins da ist. Wer ihn wahrnehmen möchte, kann ihn erkennen. Nach Auffassung der Tora gibt es kein zufälliges Ereignis, sondern alles steht unter g’ttlicher Aufsicht. Es kann vorkommen, dass wir manches nicht verstehen, aber es gibt ein Zusammenwirken diverser »Zufälle« und viele Vorkommnisse, die unschwer den verborgenen G’tt erkennen lassen.
Werfen wir einen Blick auf eine Reihe scheinbar zufälliger in der Estherrolle berichteter Ereignisse:
1. König Achaschwerosch will die Schönheit seiner Gemahlin Vaschti vorführen. Sie aber weigert sich und verliert so das Königtum.
2. Esther wird als neue Königin ausgewählt, ein Mädchen, dessen Abstammung nicht bekannt ist. Sie hat keine Eltern mehr. Ihr Vormund ist Mordechai.
3. Mordechai erfährt, dass die Höflinge Bigtam und Teresch einen Anschlag auf den König planen und rettet ihn.
4. Mordechai wird nicht unmittelbar für die Rettung des Königs belohnt, sondern lediglich in einem Gedenkbuch verzeichnet.
5. Esther begibt sich ohne Audienzerlaubnis in den Thronhof zum König. Er begnadigt sie durch Ausstrecken seines Zepters von der Todesstrafe für unerlaubte Annäherung. Esther bittet um eine Zusammenkunft mit ihm, ihr und dem judenfeindlichen Minister Haman. Der König kann in dieser Nacht nicht schlafen und lässt sich aus dem Gedenkbuch vorlesen.
6. Das Buch wird gerade an der Stelle aufgeschlagen, an der es um die Mordechai aufgedeckte Verschwörung gegen den König geht.
7. Am Morgen stellt sich Haman ein, um mit dem König über seine persönlichen Rachepläne gegen Mordechai zu sprechen.
8. Achaschwerosch kommt gerade in dem Augenblick in den Saal der gemeinsamen Mahlzeit mit Esther und Haman zurück, da Haman sich über das Polster, auf dem Esther liegt, wirft, und sie bedrängt, ihm Gnade zu gewähren.
9. Einer der Beamten des Königs kommt hinzu und berichtet, dass Haman schon einen Galgen für die Hinrichtung Mordechais hat aufrichten lassen.
So beziehen sich viele scheinbare Zufälle aufeinander. Der Ewige, der in der Estherrolle verborgen ist, ist derjenige, der veranlasst hat, dass sich alles genau so ereignen sollte.
Das Purimfest ist nach »Pur« (hebr. Los/Schicksal) benannt. Haman, der Amalekiter, glaubte nicht an den Ewigen, sondern an das Schicksal. Er wählte den Monat Adar, weil er wusste, dass Mosche Rabbenu, der Retter des Volkes Israel, in diesem Monat gestorben war. Allerdings wusste er nicht, dass Mosche in diesem Monat, an genau dem gleichen Tag, auch geboren wurde.
Der Name des Ewigen bleibt absichtlich in der Estherrolle verborgen. Die Geschichte des Buches ereignete sich in Persien, in der Diaspora. Auch in der Diaspora können wir, ja ist es uns geboten, den Ewigen auf Schritt und Tritt zu suchen und zu finden – denn es gibt keine Zufälle. Amalek ist von der Gesinnung beherrscht, dass alles in der Welt zufällig geschieht. Das Volk Israel dagegen glaubt an die g’ttliche Vorsehung und dass sich nichts zufällig ereignet.
Das Purimwunder ist ein Beispiel für die Existenz des Volkes Israel in der Welt. Nach historischer Logik hätte Israel nicht alle Vernichtungsversuche »Hamans« und »Amaleks« überleben können. In jeder Generation stehen Hamans gegen uns auf, die uns auslöschen wollen, doch der Heilige, gepriesen sei sein Name, rettet uns aus ihrer Hand. Das Volk Israel lebt und besteht auf ewig.

Wir danken dem "jüdischen berlin" herzlich für die Übernahmegenehmigung
Haben Juden Hörner?
Den vielen Fragen, die »die Leute« über das Judentum haben, begegnet eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin mit »der ganzen Wahrheit über die Juden« – indem sie noch mehr Fragen hinzufügt. Sicher ist im Judentum nur der Zweifel. Möglicherweise.
Juden sind nicht sehr attraktiv. Ihr Mangel an Schönheit ist allerdings nicht ganz so groß wie ihr Mangel an Tierliebe. Dafür sind sie geschäftstüchtig, einflussreich und vor allem intelligent. So zumindest haben es die Besucher der Ausstellung »Die ganze Wahrheit… Was Sie schon immer über Juden wissen wollten« gesehen, die die Schau in den ersten Wochen nach ihrer Eröffnung bereits besucht haben. Kurz vor Ende des Rundgangs durch die Räume im ersten Obergeschoss des Jüdischen Museums konnten sie nämlich durch Einwurf kleiner Plastikchips in verschiedene Kästen darüber abstimmen, wie »die Juden« denn »so sind«. Bis jetzt ist der »Tierlieb«-Kasten noch kaum gefüllt, und um die mit »Schön« betitelte Box steht es auch nicht viel besser. Hundertfach wurde dagegen für die anderen drei Kategorien abgestimmt. Also alles beim Alten? Ja und nein.
Sicher ist im Judentum eh nicht allzu viel, wenn man der Botschaft der Kuratorinnen folgt. Diese These belegen sie eindrücklich mit einer gelungenen Videoinstallation: Sechs Rabbiner und eine Rabbinerin, orthodoxe, liberale und konservative, beziehen Stellung zu zentralen Fragen des Judentums. Sieben verschiedene Stellungen, wohlgemerkt. Darf ich am Schabbat Autofahren? – Ja, wenn ich sonst nicht in die Synagoge komme, sagt der eine. Niemals, sagt der andere. Wer ist überhaupt Jude? – Wer sich als ein solcher betrachtet und verhält, sagt der eine. Wer eine jüdische Mutter hat oder übertritt, sagen die anderen. Und die Vaterjuden? Und die Getauften? Und, und, und…? Nur bei einem Thema herrscht Konsens: Im Judentum geht es ums Zweifeln, ums Fragen selbst. Jüdisch sein heißt, nicht fertig zu sein, sondern lebenslang eher an neuen Fragen als an Antworten zu wachsen. Wenigstens das ist – einigermaßen – sicher. – Die Zuschauer dieses Schlagabtauschs müssen die Köpfe wenden, um den jeweiligen Sprecher auf der Leinwand ansehen zu können. Wie beim Tennis. Oder eben: Wie bei einer Diskussion, an dem man teilnimmt. Unmerklich werden Besucher so zum Teil des großen Gesprächs, nehmen innerlich Stellung, lachen manchmal leise oder murmeln abfällig vor sich hin. Schließlich geht es hier eigentlich um sie. Es sind ihre Fragen, die die Ausstellung thematisiert.
Einige von ihnen haben auf der als Gästebuch fungierenden Wand am Ausgang, die mit eigenen Fragen beklebt werden kann, ihre Bedenken über die Idee mit den Plastikchips zum Ausdruck gebracht. Damit würden doch eh nur Klischees reproduziert. Andere finden die Abstimmung lustig, wieder andere geschmacklos. Die Zettelwand füllt sich ebenso stetig wie die »Juden sind«-Kästen, Fragen werden von anderen Besuchern beantwortet, kritisiert, gelobt und lächerlich gemacht (»Geh mal studieren! Lies mal ein Buch!«).
Unter die Fragen mischen sich Kommentare, Zustimmung und Kritik, die wiederum kritisiert werden. So entsteht ein Raum des Dialogs aller mit allen; wer vorhin noch Zuschauer war, darf und soll hier selbst zum Sprecher, Frager, Zweifler werden.
Die überall großflächig plakatierte Rede von »der ganzen Wahrheit« ist, natürlich, eine feixende Antwort – die einzige in der gesamten Ausstellung –, und zwar auf diejenigen, die an »die ganze Wahrheit« glauben, sprich: Auf all jene, die »die jüdische Identität« gern fein säuberlich als Katalog von bestimmten Eigenschaften und Verhaltensweisen aufgelistet hätten. Glücklicherweise haben die Ausstellungsmacherinnen weder diesem verbreiteten Bedürfnis nach Sicherheit durch Verdinglichung nachgegeben noch eine wohlmeinend-belehrende Völkerschau inszeniert. Vielmehr gelingt es ihnen auf wunderbar leichtfüßige Weise, dem Punkt oder gar Ausrufezeichen der eindeutig bestimmbaren Identität das Fragezeichen entgegenzusetzen – und dabei die Bürde in Kauf zu nehmen, keine einzige definitive Antwort zu geben. Es sind daher auch Fragen, die den Besucher von Anfang bis Ende durch die Schau geleiten. Warum gibt es Beschneidungen? Warum mag keiner die Juden? Sind alle Juden religiös? Wer ist überhaupt Jude? Teeniestar Justin Bieber vielleicht? Immerhin hat der ein hebräisches Tattoo. Oder Whoopie Goldberg (bei dem Nachnamen)? Oder doch Elvis oder (der von Rabbi Jacob Snowman beschnittene) Prince Charles? Was ist mit Harald Martenstein? Und warum will man das eigentlich so genau wissen? Übrigens: Der Satan, der ist eindeutig echad mischelanu. Er hört auf den Namen Bernie Madoff, war mal, tja, »Finanzoptimierer« in Manhattan und kann in der Ausstellung als Actionfigur mit Pferdefuß und Dreizack (plus Hörnern!) bewundert werden. Dazu gibt es übrigens einen Hammer, denn der Bernie-Satan aus Plastik ist vollständig »destructible«. Ein kleiner Trost für die Opfer seiner finanziellen Teufeleien.
»Die ganze Wahrheit über die Juden« lautet also: Es gibt keine. Was es gibt, sind vielfältige Perspektiven, Lebensformen, Denkweisen, Klischees – und Weisen der Erinnerung. Darf man über den Holocaust lachen? In Deutschland scheinbar nur dann, wenn Oliver Polak auftritt. Zumindest ist seine Comedy-Produktion die einzige deutsche, die hier präsentiert wird. Den größeren (und weitaus lustigeren) Teil übernehmen Amerikaner, genauer: amerikanische Juden, wie etwa der geniale »Seinfeld«-Erfinder Larry David, der in einer Episode seiner TV-Serie »Curb Your Enthusiasm« zwei Überlebende zusammenbringt – von denen allerdings nur einer das KZ, der andere dagegen eine Art TV-Dschungelcamp im australischen Busch »überlebt« hat. Die entstehende »Opferkonkurrenz« zwischen den beiden (»Haben Sie die Show überhaupt mal gesehen?« – »Haben Sie unsere mal gesehen? Sie hieß Holocaust!«) wird von David auf so derart komische Weise ausgeschlachtet, dass Lachen unvermeidlich ist. Denn was hier den jüdischen Witz vom Judenwitz unterscheidet, ist natürlich die offenkundige Absurdität des Vergleichs. So bleibt die Würde des »echten« Überlebenden in jedem Moment gewahrt – eine Voraussetzung für jede humoristische Auseinandersetzung mit der Schoa. Wer etwas ganz genau wissen will, kann übrigens auch Juden live befragen. Die sitzen nämlich zu der Frage »Gibt es noch Juden in Deutschland?« in einem Glaskasten und stehen für Auskünfte aller Art zur Verfügung. Hingehen!
Frank Lachmann
_ bis 1. 9. 2013, Jüdisches Museum Berlin, Lindenstraße 14, Berlin-Kreuzberg, Montag 10-22 Uhr, Dienstag-Sonntag 10-20 Uhr
Wir danken dem "jüdischen berlin" herzlich für die Übernahmegenehmigung
Vom Pazifik bis nach Nordafrika
1,5 Millionen Juden kämpften als Soldaten alliierter Armeen gegen Hitlerdeutschland
Lionel Cohen, der älteste aktive Pilot der Royal Air Force, der an 70 Kampfeinsätzen über dem Atlantik teilnahm, der in Indien geborene Jacob Jacob, der im Fernen Osten gegen Hitlers japanische Verbündete kämpfte, der als Pole aus der Sowjetarmee entlassene Benjamin Siegel, der mit einem polnischen Infanterieregiment an der Eroberung Berlins beteiligt war, die Moskauer Kampfpilotin Lydia Litwak, die 22-jährig tödlich abgeschossen wurde, Tuvia Bielski, der mit seinen drei Brüdern einen zähen und erfolgreichen Partisanenkampf gegen die deutschen Besatzer in Weißrussland führte, der New Yorker Drehbuchautor Hermann Wouk, der bei der Landung auf sieben Pazifikinseln dabei war, Reuben Herscovitz, der als »Special Operator« die deutsche Flugkontrolle mit in seinem Bomber eingebauten Störsendern lahmlegte, der norwegische Pilot Jo Benkow, der nach dem Krieg unter anderem Parlamentspräsident Norwegens war, die Pariserin Denise Bloch, die über dem besetzten Frankreich absprang, um Bahngleise zu sprengen und die im KZ Ravensbrück ermordet wurde, der in Algerien geborene José Aboulker, der mit 400 Widerstandskämpfern die Mobilmachung der Vichy-Truppen in Algier verhinderte, Salomao Malina, der als Mitglied des brasilianischen Expeditionskorps in Italien Breschen in feindliche Minenfelder schlug, oder die Panzerbrigadekommandeure Abram Temnik und Jewsej Weinrub, die den Angriff auf den Reichstag anführten.
Sie alle haben eines gemeinsam: Sie waren Juden und kämpften gegen Hitlerdeutschland. Und sie alle (und etliche mehr) werden in der unlängst bei Hentrich & Hentrich in Berlin erschienenen Miniatur »An allen Fronten. Jüdische Soldaten im Zweiten Weltkrieg« von Wladimir Struminski mit Kurzbiografien und Fotos vorgestellt.
Manchen Leser mag das erstaunen, ist doch der Mythos von den jüdischen Drückebergern und den Juden, die sich wie Lämmer hätten zur Schlachtbank führen lassen, noch immer nicht ganz verklungen. Denn anders als die Schoa selbst gehört die Geschichte der jüdischen Soldaten in den alliierten Armeen zu den weniger bekannten und erforschten Kapiteln des letzten Krieges. Und doch waren unter den 70 Millionen Weltkriegssoldaten, die gegen die Achsenmächte kämpften, anderthalb Millionen Juden. Die meisten von ihnen, 550000, dienten in der US-Armee (4,5 % der Bevölkerung), 500000 in der Roten Armee (1,5% der Bevölkerung) und 180000 in den polnischen Streitkräften (10% der Bevölkerung). Aber auch in der kanadischen, französischen, griechischen, südafrikanischen und britischen Armee (vor allem im Mandatsgebiet Palästina) war die jüdische Beteiligung hoch. Hinzu kamen über 90000 jüdische Partisanen und Untergrundkämpfer.
Die 10000 deutschen Juden, die vor allem im amerikanischen und britischen Militär dienten, waren besonders motiviert – ihre Eltern, ihre Familien befanden sich meist noch in Deutschland, mitten im Auge des Bösen, oder waren bereits ermordet worden. Aufgrund ihrer Sprachkenntnisse und kulturellen Vertrautheit wurden sie vor allem im Nachrichtendienst, als Übersetzer und bei Gefangenenbefragungen eingesetzt, oder wie die »Special Interrogation Group« als falsche deutsche Soldaten.
Die Juden in der Sowjetarmee wurden nicht in eigenen Brigaden zusammengefasst. Ihre Situation unterschied sich von der in anderen Armeen. Die sowjetische Führung ließ Auszeichnungen für Juden nur begrenzt zu und verschwieg, wenn möglich, auch deren Kampferfolge und Mut. Viele jüdische Rotarmisten verschwiegen auch von sich aus ihre Herkunft, denn bei einer Gefangennahme durch die Deutschen wurden sie in der Regel sofort erschossen. Bis zu 40% der 200000 jüdischen Gefallenen in der Roten Armee sind nicht im Kampf gestorben, sondern nach der Gefangennahme ermordet worden.
Ähnlich wie den jüdischen Rotarmisten erging es polnischen Juden in deutscher Gefangenschaft. Dennoch drängten sie massenweise in die polnischen Exiltruppen, wenn man sie ließ. Die in der Sowjetunion aufgestellte Anders-Armee beispielsweise verweigerte Juden den Zutritt, während diese in der polnischen Westarmee in Frankreich 17% aller Soldaten stellten.
Juden kämpften im Pazifik, landeten in der Normandie, vertrieben die Wehrmacht aus Nordafrika und Stalingrad, operierten in jugoslawischen Wäldern und waren in der französischen Résistance aktiv – wie die Juive de Combat, deren Kämpfer mit Davidsternarmbinde sogar deutsche Militärzüge »kidnappten«…
Als der Krieg endlich vorbei, war das für viele jüdische Soldaten noch nicht das Ende des Einsatzes. Denn drei Jahre später begann der israelische Unabhängigkeitskrieg. In ihn zogen 110000 jüdische Soldaten, davon 30000 Auslandsfreiwillige. Letztere waren von unschätzbarem Wert. Mit ihren im Weltkrieg gewonnenen militärischen und taktischen Erfahrungen stärkten sie die vorhandenen paramilitärischen Organisationen, die zuvor jüdische Ortschaften vor arabischen Überfällen geschützt oder die britische Mandatsherrschaft mit Störaktionen geschwächt hatten, aber keine ausgebildeten Militärs waren. Das »Know How« der jüdischen Auslandssoldaten wurde zu einer kriegsentscheidenden Größe im Unabhängigkeitskrieg. »Der Sieg war ein psychologischer Befreiungsschlag – nicht nur für die Kämpfer, sondern für die jüdische Welt insgesamt«, schreibt der Autor des lesenswerten Büchleins. Diese jüdischen Soldaten hätten den Worten »Nie wieder« einen tiefen, historischen Sinn gegeben.
Judith Kessler
Wir danken dem "jüdischen berlin" herzlich für die Übernahmegenehmigung
Engagierte Lehrer und engagierte Eltern
Elternsprecherin Miriam Rothholz über die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule am Jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn
Ihre Tochter Naomi (10) besucht seit diesem Schuljahr die 5. Klasse des Jüdischen Gymnasiums. Sie sind nicht nur zur Elternsprecherin der Klasse 5, sondern auch zur Gesamtelternsprecherin gewählt worden. Wie gestaltet sich aus Elternsicht der Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium?
MR: Natürlich ist für die meisten Kinder der Schulweg länger geworden, was unter anderem auch früheres Aufstehen bedeutet. Die Länge des Schultages waren wir von der Galinski-Grundschule schon gewöhnt, allerdings arbeiten viele Kinder immer noch daran, sich an Umfang und gelegentlich auch die Art und Weise der Hausaufgaben zu gewöhnen. Fragen Sie unsere Kinder, so werden Sie in erster Linie erfahren, wie toll – cool – sie es finden, mit den Großen auf eine Schule zu gehen. Auch die für manche neuen Fächer Religion und Hebräisch werden von vielen als etwas ganz Besonderes beschrieben.
In vielen Elterngesprächen habe ich festgestellt, dass die gymnasialen Anforderungen, die weniger spielerisch daher kommen, und die stärkere Schwerpunktsetzung auf selbstständiges Lernen und Arbeiten im Unterricht für viel Gesprächsbedarf sorgen. Die Eltern sind alle sehr interessiert daran, was und wie unsere Kinder in der Schule lernen, aber durch den engen Kontakt zwischen Eltern und Lehrern können Missverständnisse als solche schnell erkannt oder kleinere Probleme gelöst werden, bevor daraus große werden. Allerdings kann ich feststellen, dass wir alle – Eltern und Kinder – mehr oder weniger intensiv daran arbeiten müssen, das Mehrtunmüssen am Gymnasium zu akzeptieren.
Viele Berliner Viertklässler und deren Eltern machen sich zum Ende des Schuljahres Gedanken über den Wechsel aufs Gymnasium: »Zu früh«, »Ende der Kindheit« und »Überlastung« sind nur einige Stichworte, die Eltern beschäftigen. Wie gestaltete sich das in Ihrer Familie? Inwiefern hat das Jüdische Gymnasium Eltern und Schülern beim Übergang aufs Gymnasium unterstützt?
Meine Tochter freute sich von Anfang an auf die neue Schule. Offen und kontaktfreudig wie sie nun mal ist, sah ich da kaum Probleme. Schon beim Kennenlernnachmittag am Ende der vierten Klasse konnten alle Schüler sich gegenseitig und die neue Schule beschnuppern. Da kamen erst gar keine Ängste auf. Auch jetzt kann ich sagen, dass sich der engagierte und ambitionierte Eindruck, den die Lehrer damals auf die Eltern machten, im Schulalltag bestätigt hat. Die Fachlehrer beantworten geduldig alle Schülerfragen und achten nebenbei noch darauf, dass sich gymnasiale Arbeitstechniken entwickeln, indem sie immer wieder daran erinnern. Durch den engen Kontakt zur Schule habe ich heute mehr Einblick in die Anforderungen, die das Gymnasium und der Schulalltag an unsere Zehnjährigen stellt. Zum Beispiel die vielen Exkursionen, mit denen in den verschiedenen Fächern der Unterrichtsstoff mal nicht im Klassenraum, sondern eben vor Ort im Museum, im Theater oder in einer Ausstellung vermittelt wird, sind nicht nur ein Highlight im täglichen Schuleinerlei. Sie stärken auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Klasse und das Selbstbewusstsein des Einzelnen. Das wird von den Eltern als große Bereicherung empfunden.
Nun sind Sie ja nicht nur für die Klasse ihrer Tochter verantwortlich, sondern als Teil des Gesamtelternvertreterinnen-Teams für alle Eltern der Schule Ansprechpartnerin. Wie sieht Ihre Bilanz nach dem ersten Schulhalbjahr aus?
Als Elternvertreterin bin ich in erster Linie Ansprechpartnerin für andere Eltern, deren Sorgen und Nöte. Viele scheinbaren Probleme auf Elternseite lassen sich schon dadurch klären, dass wir Eltern uns darüber austauschen. So sehen dann Eltern Probleme, die zu Hause noch riesengroß und unlösbar schienen, schnell mal realistischer und sind für Ratschläge anderer Eltern offen.
Mirjam Rothholz (r.) mit der Direktorin Barbara Witting und der Vorsitzenden des Fördervereins, Brigitta Hayn (l.). Hauke Cornelius
Zunehmend finde ich mich aber auch in einer Art Vermittlerrolle zwischen Eltern und Lehrern. Eltern klagen mir ihr Leid über den einen oder anderen Lehrer, die eine oder andere als ungerecht hoch empfundene Anforderung. Auch hier zeigt sich für mich immer wieder, dass kurze Wege und offene Gespräche dazu beitragen, dass sich beide Seiten verstanden fühlen und gemeinsam eine Lösung suchen. Oft stellt sich dabei heraus, dass alles gar nicht so schlimm war, wie es noch zu Hause am Esstisch erschien.
Den Sorgen, Nöten und Verbesserungsvorschlägen der eigenen Klasse als Elternsprecherin gerecht zu werden ist die eine Sache. Eine andere Sache ist es, die gesamte Elternschaft zu vertreten. Hier profitiere ich natürlich von der langjährigen Erfahrung von Anne Mahn, die den Job der Gesamtelternvertreterin seit fünf Jahren sehr erfolgreich bewältigt.
Mit der Schulleitung und den Lehrern arbeiten wir eng zusammen, um die Schule und die Schulelternschaft nach außen, auch gegenüber dem Schulträger, zu vertreten. Innerhalb der Schulgemeinschaft sind wir immer offen für die Gedanken, Ideen und manchmal auch Sorgen von Lehrern, Eltern und Schulleitung. So bin ich sehr froh, dass wir auf der letzten Gesamtelternvertretersitzung lange mit Frau Hayn, der Präsidentin des Fördervereins der Schule, sprechen konnten. So konnten Kontakte zwischen Eltern, Schule und Förderverein hergestellt bzw. konkretisiert werden, die uns allen helfen. Wie nennt man das so schön Neudeutsch: Synergieeffekte generieren. Auch darin sehe ich meine Aufgabe.
Schließlich gehört es zur jüdischen Tradition, sich der Gemeinschaft nicht nur zugehörig, sondern auch verpflichtet zu fühlen. Keiner wird ignoriert, keiner wird allein gelassen, keiner wird zurückgelassen. Für mich und meine Familie ist das selbstverständlich. Deshalb freue ich mich besonders, dass sich immer mehr Eltern für den Förderverein und die Schule engagieren, denn schließlich kommt es doch unseren Kindern zugute, wenn wir als Eltern dafür Sorge tragen, dass z.B. eine kaputte Tischtennisplatte auf den Schulhof schnell ersetzt oder ein dringend benötigtes Musikinstrument angeschafft wird.
Mit Blick auf die zahlreichen Veranstaltungen zum Schuljubiläum möchte ich betonen, dass sich viele Eltern regelmäßig für die Schule engagieren. Denken Sie nur an das riesige Kuchenbüffet, das mit schöner Tradition von der Elternschaft zum Schulfest ausgerichtet wird. Der Kultursplitter und die Theateraufführungen der Schüler werden gern und regelmäßig von vielen Eltern besucht. Viele Elternsprecher nehmen ihre Verantwortung sehr ernst und besuchen Fachbereichssitzungen, um dort zum einen Elterninteressen zu vertreten. Zum anderen aber auch, um über die Gesamtelternvertretung die Eltern auf dem Laufenden zu halten, was in den einzelnen Fachbereichen wichtig ist und diskutiert wird.
In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend gleich für den Eltern-Newsletter werben, den bisher ca. 250 Abonnementen beziehen. Betreut von einem Vater, Gerald Praschl, haben wir hier ein gutes Instrument, Eltern schnell und unkompliziert auf dem Laufenden zu halten. Manchmal habe ich ein Sitzungsprotokoll schon in meiner Mailbox, wenn ich noch auf dem Heimweg bin.
Über jgmmendelssohngev(at)me.com können interessierte Eltern den Newsletter abonnieren.
Das Gespräch führte Hauke Cornelius
Wir danken dem "jüdischen berlin" herzlich für die Übernahmegenehmigung
Opfer und Opfermacher
von Ernst Meir Stern

„Du Opfer“ ist ein Modeschimpfwort unter Jugendlichen. Peter Menasse, kein solcher mehr, Chefredakteur des Magazins NU und Autor des jüngst publizierten Büchleins „Rede an uns“, ließ sich davon inspirieren. Leider.
Denn seither wird er bei Medienauftritten nicht müde, „den“ Juden pauschal vorzuhalten, immer noch primär in der Opferrolle zu verharren und sich dementsprechend – fehl -zu verhalten. Zudem beklagt er (Radio Wien am 2. Februar), dass aus der jüdischen Gemeinde keine Reaktionen auf seine Philippika zwischen Buchdeckeln erfolgten.
Diese beiden, vom werten Kollegen beklagten Umstände, stehen durchaus ursächlich in Zusammenhang. Nach Lektüre der „Rede an uns“ wage ich Widerspruch, behaupte, Menasse hat erstens recht und zweitens überhaupt nicht! Ein Widerspruch im Widerspruch?
Der Autor bietet auf nicht weniger als 106,5 Seiten unzählige starke Argumente auf, um zu beweisen, dass das Verharren in der Opferrolle, einhergehend mit der inflationär gebrauchten „Antisemitismuskeule“ und Berufung auf die Shoa unzeitgemäß, großen Bevölkerungsteilen gegenüber ungerecht und letztlich für das Judentum nur kontraproduktiv ist.
Recht gesprochen! Indes – Menasse begeht den fatalen journalistischen Fauxpas, ein undifferenziertes Pauschalurteil abzugeben und nicht wahrzunehmen, resp.zu negieren, dass der überwiegende Teil des hiesigen Judentums die ihm unterstellte Mentalität längst abgestreift hat!
Ohne mich hier auf Untiefen einer psychologisierenden Debatte einzulassen, zu der ich mich nicht berufen fühle, möchte ich mich auf Fakten beschränken. Sicherlich gibt es noch Juden, die, zutiefst traumatisiert, in einem körperlichen und/oder seelischen Zustand verharren, den wir als klassische Opferhaltung bezeichnen müssen. Und natürlich werden Juden durch antisemitisch motivierte Äußerungen und Gewalttaten (die in ganz Europa dramatisch zunehmen), immer wieder auf die Rolle als Opfer zurückgeworfen, ob ihnen dies nun genehm ist oder nicht.
Verstärkt wird dies noch durch Aussagen von Politikern sowie Medienberichte, deren Urheber infolge Ignoranz oder einfach schlechter Recherche nicht realisieren, dass Juden dieses Landes in ihrer großen Mehrheit sich längst nicht mehr mit einer derartigen Rolle identifizieren und versuchen, trotz des „Rucksacks der Geschichte“ ein stinknormales Leben zu führen.
Politiker, und ganz besonders österreichische, werden ,als Ausdruck ihrer Gesinnung oder auch nur Pflichtübung in Vergangenheitsbewältigung, nicht müde, in herzerweichender Weise die Shoa und ihre Opfer zu erwähnen, aber für ein hier und heute existierendes, selbstbewusst auftretendes Judentum bringen sie weit weniger Emphatie auf.
Davon weitgehend unbeeindruckt, versucht das hiesige Judentum in seiner überwiegenden Mehrheit, Normalität zu leben. Man geht seiner Arbeit und Geschäften nach, pflegt dadurch Kontakte und Freundschaften auch zu Nichtjuden, vermittelt den Kindern eine möglichst gute Erziehung, engagiert sich in Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der jüdischen Gemeinde.
Die „gepackten Koffer“ im Vorzimmer sind längst nur noch eine „urban legend“. Die Jugend geht zur Schule oder an die Uni, versucht, ihre berufliche Zukunft zu gestalten, betreibt Sport, feiert Partys, lebt ihre zeitgeistige Jugendkultur, und pflegt intensive Kontakte auch zu nichtjüdischen Freundinnen und Freunden. Nicht wenige engagieren sich gleichfalls in ihrer Gemeinde (auch „wehrhaft“ im Sinne einer Forderung von Menasse) oder angelegentlich für Israel. Sieht das alles nach Opferrolle und weinerlichem, kollektiv gepflogenem Selbstmitleid aus?
Möglicherweise wähnen sich viele Glaubensgenossen vor lauter Normalität sogar schon allzu sehr „auf der sicheren Seite“. Wie auch immer, sie haben heute wahrlich besseres zu tun, als sich an einer Opfermentalitäts - Debatte zu beteiligen, die vor vierzig, fünfzig, Jahren noch ihre Berechtigung hatte und mit Funktionären der Kultusgemeinde auch heftig geführt wurde. Daher darf sich Menasse auch nicht wundern, dass sich ausschließlich nichtjüdische Kreise an dem Thema öffentlich abrackern.
Intensiv abgearbeitet hat sich Peter Menasse auch am Ehrenpräsidenten der IKG, Dr. Ariel Muzicant.
Vom Autor auch als „Strippenzieher“ bezeichnet, wird ihm im Buch mehrfach vorgeworfen, die „Shoa- und Antisemitismuskeule“ während seiner Präsidentschaft instrumentalisiert und auch bei nichtigen Anlässen geschwungen zu haben.. Nun ja, jeder kennt das Umfeld des NU – Chefredakteurs und ein Schelm, wer dabei Böses wie an politisches Kalkül oder geschickte Promotion in eigener Sache denkt…
Selbst im zeitgeschichtlichen Kontext hält die These von der Opfermentalität nicht. Die Mär, dass sich Juden „wie Schafe zur Schlachtbank führen“ ließen, ist längst als solche widerlegt und eine noch nachträgliche Verhöhnung durch unsere Feinde. Wo immer es nur möglich war, wuchsen Juden aus eigener Kraft aus dem für sie vorgesehenen Opferstatus hinaus, leisteten passiven und bewaffneten Widerstand. Schon die erste Nachkriegsgeneration bezog einen Teil ihrer Identität aus dieser Haltung.
Wenn Vertreter der Kultusgemeinde sich daher in deutlichen Statements gegen rassistische Äußerungen und Handlungen wenden oder energisch jüdische Rechte einfordern, ist dies keineswegs Ausdruck einer Opfer- Mentalität, sondern vielmehr des gesunden Selbstbewusstseins einer Generation, die nicht länger leisetreten und sich ängstlich ducken will! Ja, es stimmt schon, für viele Politiker, Publizisten, Philosemiten, religiöse Kreise und natürlich auch Ewiggestrige ist es einfacher und selbstbefriedigender, Juden in die traditionelle Opferecke zu stellen. Wir sollten ihnen nicht auch noch den Gefallen tun, sie in ihren Überzeugungen und ihrem Tun durch entbehrliche Reden an uns zu bestärken.
| Israel bedauert österreichischen Rückzug aus UNDOF-Mission |
|
Zur Entscheidung der österreichischen Regierung, die Soldaten des Landes aus der UNDOF-Mission auf den Golan-Höhen abzuziehen, heißt es in einer Stellungnahme des Außenministeriums:

Israelisch-syrische Grenze (Foto: IDF)
„Wir sind dankbar für Österreichs langjährigen Einsatz und das Bekenntnis zum Frieden im Nahen Osten. Daher bedauern wir diese Entscheidung und hoffen, dass sie nicht zu einer weiteren Eskalation in der Region beitragen wird.
Israel erwartet, dass die Vereinten Nationen ihr Engagement gemäß der Resolution 350 (1974) des UN-Sicherheitsrats aufrechterhalten, die zur Gründung der UNDOF-Mission führte.“
(Außenministerium des Staates Israel, 06.06.13)
|
Das Pack schweigt
von Henryk M. Broder

Stellen Sie sich einmal vor, in Gaza stehen Menschen vor einer Bäckerei an und warten auf eine Brotlieferung. Denn Brot ist knapp in Gaza, wie damals im Warschauer Ghetto. Da kommen israelische Kampfjets angeflogen und bombardieren die Bäckerei und die Menschen, die davor stehen. Es gibt viele Tote, 60, 90 oder noch mehr und Dutzende von Verletzten. Natürlich ist kein Kamerateam der ARD oder des ZDF zur Stelle, denn die Kollegen sind bereits im Weihnachtsurlaub. So müssen die Nachrichtenagenturen auf verwackelte Bilder zurückgreifen, die offenbar mit Mobiltelefonen aufgenommen wurden. Aber auch diese sind schrecklich genug. Überall Tote auf den Straßen, Menschen, die versuchen, Verletzte zu bergen, ein Mann schleppt eine Frau auf seinem Rücken vom Platz.
Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, was daraufhin in Deutschland los wäre. Sondersendungen in ARD, ZDF, RTL, SAT1,n-tv, n24. Aufgebrachte Kommentatoren, die sich vor Empörung und Entsetzen nicht mehr einkriegen. Diesmal sei Israel zu weit gegangen, habe die rote Linie überschritten, das sei keine Selbstverteidigung sondern Massenmord. Das könne man, bei allen Sympathien, dem jüdischen Staat nicht durchgehen lassen. Jetzt müsse endlich etwas passieren, um das Blutvergießen zu beenden, die Spirale der Gewalt müsse endlich angehalten werden. Der Bundestag würde zu einer Sondersitzung zusammentreten, die Bundesregierung den israelischen Botschafter einbestellen, die EKD und die Deutsche Bischofskonferenz würden sich “bestürzt” zeigen und zu Gebeten aufrufen.
Nun sind bei einem Angriff der syrischen Luftwaffe auf eine Bäckerei in der Stadt Halfaja in der Provinz Hama Dutzende von Menschen getötet und verstümmelt worden. Kleinkram, könnte man sagen, angesichts von mittlerweile über 40.000 Toten im syrischen Bürgerkrieg. Aber für eine kleine Laola-Welle der deutschen Friedensbewegung müsste es reichen, handelte es sich doch bei den Opfern des Angriffs eindeutig um Zivilisten.
Aber nix da. Das links-reaktionäre Gutmenschenpack (LRGMP) schweigt beharrlich und vernehmlich, so wie es immer schweigt, wenn Araber andere Araber massakrieren. Inge Höger schweigt. Annete Groth schweigt. Bettina Marx schweigt. Norman Paech schweigt. Die Tochter schweigt. Rolf Verleger schweigt. Rupert Neudeck schweigt. Ruprecht Polenz schweigt. Die Free Gaza Bewegung schweigt. Ludwig Watzal gönnt sich noch einen und schweigt. Pax Christi schweigt. Der Aachener Friedenspreis schweigt. Das Netzwerk Friedenskooperative schweigt. Die Horber Initiative für den Frieden schweigt. Der Friedensladen Heidelberg schweigt. Das Bad Schussenrieder Bündnis für den Frieden schweigt. Das Friedensplenum Tübingen schweigt. Die Friedensstaat Osnabrück schweigt.
Die Friedensstadt Augsburg schweigt. Die Friedensstaat Münster schweigt. Die Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen schweigt. Der Friedensverein “HAND IN HAND” schweigt. Jürgen Todenhöfer schweigt. Claudia Roth, die eben noch Israel geraten hat, mit dem “pragmatischen Teil” der Hamas zu verhandeln, hat dem Tagesspiegel kurz vor dem Fest ein Interview gegeben und sich in ihre Datsche in der Türkei verabschiedet.
So herrscht Schweigen im Land. Es sind ja nur Araber unter sich.
Siehe auch.
http://www.tagesschau.de/ausland/syrien2492.html
http://www.tagesschau.de/ausland/syrien2490.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio99580.html
http://www.tagesschau.de/ausland/syrien2478.html
Der Beitrag wurde erstmals unter
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/das_pack_schweigt1/
publiziert und erfolgt mit Einwilligung des Autors.
Bild: Henryk M. Broder (c) lizaswelt.
„Die israelische Queen“
Mit einem großen Festakt zum 90. Geburtstag von Präsident Shimon Peres ist am Dienstagabend die fünfte „Presidential Conference“ eröffnet worden, die gleichzeitig im Zeichen des 90. Geburtstags von Präsident Shimon Peres steht.
Präsident Peres bei seiner Eröffnungsrede (Foto: Präsidialamt)
Gäste des Abends waren neben Ministerpräsident Binyamin Netanyahu, Generalstabschef Benny Gantz, Sänger Shlomo Artzi und vielen weiteren israelischen Prominenten unter anderem auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand und der Schauspieler Robert De Niro.
Präsident Peres und Shlomo Artzi (Foto: Präsidialamt)
Erster Redner des Abends war der frühere britische Premierminister Tony Blair. Er fasste die Verdienste Peres‘ um den Staat Israel zusammen, indem er sagte: „Wir haben unsere Queen, und Sie haben Ihren Shimon.“
Streisand, Clinton, Peres und Netanyahu (Foto: PMO)
Ministerpräsident Netanyahu erklärte: „Shimon, Sie beweisen, dass es möglich ist, in jedem Alter neugierig und jung zu sein.“
Der frühere US-Präsident Bill Clinton sagte in seiner Rede, Peres sei es gelungen, eine Theorie der Bedeutung, Philosophie, Politik, Psychologie, Technologie und Gesellschaft zu entwickeln. Diese würde eines Tages sowohl in Israel als auch weltweit Realität werden.
Im Anschluss an Clinton folgte ein Auftritt von Sängerin Barbra Streisand.
Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus der ganzen Welt, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, gratulierten Peres per Videobotschaft.
(Präsidialamt/Ynet, 18.06.13)
Die fünfte „Presidential Conference“ wird am Mittwoch und Donnerstag zwischen acht und neunzehn Uhr MESZ live im Internet übertragen unter http://bit.ly/PresConf13
Uni Tel Aviv und Technion bieten Online-Kurse an
Die Universität Tel Aviv und das Technion in Haifa haben am Sonntag bekannt gegeben, dass sie sich dem Projekt Coursera anschließen werden, das bereits von 80 Universitäten weltweit, darunter die Hebräische Universität Jerusalem, betrieben wird.

Universität Tel Aviv (Foto: David Shay)
Coursera ist das weltweit größte E-Learning Projekt. Es wurde ursprünglich von zwei Professoren der Computerwissenschaften an der Stanford University gegründet und erreicht inzwischen Studierende überall auf der Welt.
Die beiden israelischen Neuzugänge werden zunächst vier Kurse in Ingenieurswissenschaften, Archäologie, Biologie und Kulturstudien anbieten. Der erste Kurs des Technion wird in Englisch und Arabisch unterrichtet und behandelt die Themen Nanotechnologie und Nanosensoren.
An der Hebräischen Universität hat man bereits erste Erfahrungen mit dem Online-Studium gemacht und ist sich auch der Kritik bewusst, die vor allem in den vergangenen Monaten laut wurde, langfristig litte die Qualität der Lehre unter dem Modell und es werde an Lehrpersonal gespart. In Jerusalem sieht man eher die Vorteile des Online-Studiums.
40.000 Studierende hatten sich in den Online-Kurs von Idan Segev eingeschrieben, der vergangene Woche zu Ende gegangen ist. Weniger als 2.500 haben allerdings die zugehörige Prüfung abgelegt – ein Anteil, der dem anderer Online-Kurse entspricht. Segev bezeichnet das Seminar als „das anstrengendste Seminar, das ich je gegeben habe. Es ist emotional sehr schwierig, den Studierenden nicht in die Augen sehen zu können, die zeigen, ob sie verstanden haben oder nicht. Ich habe noch niemals 40.000 Studierende auf einmal unterrichtet.“ Dennoch ist der Dozent stolz auf den Kurs.
Auch Vizerektorin Orna Kupferman steht hinter dem Modell: „Einige sagen, dass es in 15 Jahren bereits keine Universitäten mehr geben wird, wie wir sie heute kennen und dass stattdessen 10 Universitäten die ganze Welt unterrichten“, so Kupferman. „Wir möchten eine dieser 10 Universitäten sein.“
(Haaretz, 17.06.13)
7,1% sind reformiert oder konservativ
7,1% der Juden in Israel bezeichnen sich selbst als reformiert oder konservativ. Dies geht aus dem israelischen Demokratieindex für 2013 hervor.

(Foto: PhotoStock)
Gemessen an der Tatsache, dass es in ganz Israel lediglich 110 reformierte und konservative Gemeinden gibt, scheint diese Zahl erstaunlich hoch – tatsächlich jedoch ist sie gegenüber dem Vorjahr (8%) noch gesunken.
Eine der während des diesjährigen Demokratieindex gestellten Fragen lautete: „Fühlen Sie sich einer der Strömungen im Judentum zugehörig, und wenn ja, welcher?“ Ergebnis der Umfrage war, dass 3,9% der jüdischen Teilnehmer der Studie sich dem reformierten Judentum zugehörig fühlen, 3,2% dem konservativen und 26,5% dem orthodoxen Judentum. Die übrigen 66,4% der jüdischen Befragten fühlten sich keiner der drei Richtungen zugehörig.
(Haaretz, 11.06.13)
Schmähbrüder unter sich

Bild: Michael Häupl (links) mit Paul C. Eisenberg
(Copyright: PID/ Alexandra Kromus)
Bürgermeister Michael Häupl überreicht Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Ist es der Beginn der Abschiedstournee nach 30 Jahren für den obersten Rabbiner Wiens?
Der regionale Regierungschef des Landes Wien überreichte dem
dem Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. An der Ehrung im Wiener Rathaus nahmen etwa 60 Leute teil, darunter die Spitze der jüdischen Gemeinde Wien.
Häupl reduzierte Eisenberg auf seine öffentliche Wahrnehmung in den Medien, die um und mit Witzen gewürzt ist. "Lachen ist ein Zeichen der Offenheit und Toleranz", zitierte der hemdärmlig leutselige Bürgermeister
den Rabbiner. Er würde allen Anzeichen von Intoleranz vehement entgegentreten, betonte der Chef des rot-grün regierten Wiens.
Es wäre eine durchaus ernste Sache Rabbiner zu sein, sagte Paul Chaim Eisenberg in seiner Dankesrede. Besonders unter den Bürgermeistern Zilk und Häupl hätten sich die Beziehungen zwischen der Stadt Wien und der jüdischen Gemeinde sehr positiv entwickelt, so Eisenberg . Der 63 jährige ist Nachfolger seines Vaters Akiba im Amt, ist seit 1978 Gemeinderabbiner- seit 1983 Oberrabiner.
In den letzen Monaten denkt der nach eigenen Angaben "bodenständige" Eisenberg mal mehr- mal weniger intensiv über einen vorzeitigen Rückzug in den Ruhestand nach. Die Feierlichkeiten und Ehrungen zum 30-Jahre-Jubläum scheinen eine gute Gelegenheit für den Rückzug zu sein. Ob der "Schmähbruder" Paul Chaim Eisenberg dies wahrmacht, werden die
nächsten Monate zeigen.
WJC resolution on the rise of extremist parties in Europe
The 14th Plenary Assembly of the World Jewish Congress, meeting in Budapest on 5-7 May 2013,

RECALLS with great sadness the lack of appropriate and energetic action on the part of German democrats that led: to the rise to power of the Nazis; to the demise of the Weimar Republic; and to the persecution of Jews in Germany and Europe eight decades ago;
NOTES with great concern the emergence in several European countries, notably Greece and Hungary, of electorally successful, far-right and neo-Nazi parties who: openly glorify Hitler’s Nazi regime; publicly utilize Nazi terminology in respect of Jews and other minorities; and espouse the toxic combination of extreme anti-Semitic discourse, aggressive national chauvinism, and anti-capitalist and anti-socialist rhetoric that hallmarked the thinking and deeds of the Nazi Party;

NOTES also the need to raise public awareness to the development of a nascent movement in the Ukraine, which although considered marginal now has the real prospect of developing into a more serious and dangerous threat to the Jewish community.
URGES the peoples of Europe not to allow extremist hate mongers to once again undermine democracies and to defeat any such parties at the ballot box;
CALLS on Hungary to recognize that the ideology and the actions of the Jobbik movement and its subsidiaries, including the New Hungarian Guard, pose a fundamental threat to Hungary’s democracy, and that decisive action by all democratic forces against these contemporary expressions of extremism must now be taken;
URGES the Hungarian authorities to take effective measures including by enacting and enforcing legislation, for the protection of all citizens and residents of this country, in particular vulnerable minorities such as the Roma and the Jews, against threats of violence, racist hate and insults and the denial of the Holocaust;
URGES the Prime Minister of Hungary and other national leaders and legislators in Europe to join the 125 legislators from more than 40 countries, in signing the London Declaration on Combating anti-Semitism.
CALLS on parliaments and governments in countries to enact and enforce legislation, for the protection of all citizens and residents of their countries, in particular vulnerable minorities such as the Jews, against threats of violence, racist hate and insults and the denial of the Holocaust and where appropriate constitutional provisions exist, such as in Germany, to seriously and urgently consider banning neo-Nazi parties, or organizations whose aim is to overthrow the democratic order, or which pose a threat to the safety and well-being of ethnic, religious or other minorities;
RECOMMENDS that all countries, in particular those whose Jewish populations were decimated in the Shoah, implement legal measures that prohibit the public denial of the Holocaust as a manifestation of incitement to hatred against Jews.
CALLS UPON the president of the World Jewish Congress to establish a Task Force to make recommendations to the Executive Committee for the implementation of the above objectives, including an effective public education campaign.
Krieg? Nach UN – Abzug droht militärisches Wettrennen am Golan
von Ernst M. Stern
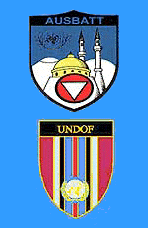
Jetzt ist es also passiert, Österreich zieht sein UN – Kontingent aus der Pufferzone am Golan zurück. Dass Israel und Österreich in außenpolitischen Belangen an einem Strang zogen, ist als ausgesprochene historische Rarität anzusehen. In diesem Fall war man sich einig, den syrischen Rebellen keine Waffen aus Europa zu liefern, da ansonsten die von europäischen Staaten gestellten UN – Kontingente am Golan ihren „Neutralitätsstatus“ verlieren und höchstwahrscheinlich selbst als Angriffsziele in Kampfhandlungen verwickelt werden.
Dieser Fall trat nun, auch ohne britisch – französische Waffenlieferungen an Rebellengruppen, ein.
Wie es aussieht, werden die Vereinten Nationen nicht so bald oder überhaupt keinen Ersatz für die Österreicher finden. Als Folge entsteht ein militärisches Vakuum, welches unvermeidlich in einem Szenario mündet, das zur Katastrophe führen kann. Nämlich einem Wettlauf sowohl der syrischen Armee und Assads Verbündeten, der Hisbollah einerseits, und der diversen Rebellen – Kontingente inklusive „Gotteskrieger“ und Al Quaida andererseits. Stellt doch die Pufferzone eine ungemein wichtige strategische Position für die Massierung größerer Truppenverbände dar.
Schon längst sind die südlichen Teile dieser Zone von syrischen Armeeeinheiten und Rebellengruppen infiltriert, ohne dass die UN – Soldaten mehr tun konnten, als ohnmächtig zu beobachten. Ein flagranter Bruch des Waffenstillstands von 1973 seitens des Assad - Regimes! Es war lediglich der bislang äußersten politisch – militärischen Zurückhaltung Israels zu danken, dass der Konflikt nicht eskalierte. Noch dazu, wo bereits Artilleriegeschosse und Granaten zum Einsatz kamen und israelische Soldaten gezielt beschossen wurden.
Israel müsste nach einem Abzug der UN - Truppen von allen guten Geistern verlassen sein, seinen Todfeinden diese Zone als Aufmarschgebiet (auch und vor allem gegen Israel) zu überlassen. Also wird Israel selbst gut beraten sein, das Gesetz des Handelns in eigene Hände zu nehmen und Truppen dorthin zu verlegen. Und das, ehe noch der Feind vor Ort Stellungen besetzt.
Politisch wäre dies natürlich verheerend, denn aus Erfahrung wissen wir, dass in diesem Fall sofort Israel von einer aufjaulenden Weltöffentlichkeit wie immer als der perfide Aggressor und Kriegshetzer gebrandmarkt wird. Doch die Sicherheit Israels hat in diesem Fall absolute Priorität – mit allen bitteren Konsequenzen.
Ein nüchternes Strategiepapier zur Zerstörung Israels – mit Koscherstempel
Von Dr. Clemens Heni*
Ein nüchternes Strategiepapier zur Zerstörung Israels – mit Koscherstempel
Micha Brumlik, die Evangelische Akademie Arnoldshain und KONKRET

Die Europäische Union wird immer größer. Am 1. Juli 2013 kam der Nationalstaat Kroatien hinzu. Kroatien ist aus dem fürchterlichen, blutigen Krieg gegen Jugoslawien in den 1990er Jahren entstanden. Dazu gibt es schon jetzt die Staaten Slowenien und Bosnien-Herzegowina, sowie „Kosovo“ und Serbien, die alle auch in die EU wollen bzw. schon Mitglied sind.
Wenn man sich den Nahen Osten anschaut, erkennt man folgende offizielle ethnisch-religiöse Konstellation (die gleichwohl nicht berücksichtigt, dass viele Menschen als religiös klassifiziert werden, obwohl sie das evtl. gar nicht sind), basierend auf Zahlen aus dem Jahr 2009: die Bevölkerung Marokkos besteht aus nicht weniger als 99% Muslimen, Algerien hat 98% Muslime, Libyen 96,6% Muslime, Saudi-Arabien 97% Muslime, Jemen 99,1% Muslime, Ägypten 94,6% Muslime, Tunesien 99,5% Muslime, die Türkei 98% Muslime, die Palästinensische Authority (PA) 98% Muslime, der Iran 99,4% Muslime, der Irak 99% Muslime, lediglich der Libanon hat 40% Christen und ‚nur‘ 59,3% Muslime, Katar, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate haben zumeist aus Gründen des Arbeitsmarktes prozentual relativ viele Migranten (bzw. Teilzeit-Migranten, Tagelöhner etc.) und zwischen 76% und 87% Muslime.
Israel hat 74,6% Juden, 16,7% Muslime, zudem christliche und andere Minderheiten.
Erinnert sich irgendjemand an aggressive, obsessive, mit Schaum vor dem Mund geführte Debatten über eine „Ethnokratie“ in Marokko, Saudi-Arabien oder der PA? Gibt es Kampagnen gegen den homogenen Charakter Marokkos, Saudi-Arabiens oder der PA?
Das einzige Land weltweit, das zumal Deutschen und den in Deutschland lebenden so sehr am Herzen liegt, dass sie es mit Lust zerstören wollen, ist Israel. Jüngstes und besonders durchdachtes, generalstabsmäßig geplantes Manöver ist ein Text des „Pädagogen“ Micha Brumlik in der einzigen Publikumszeitschrift der Linken in diesem Land, KONKRET. Bereits im letzten Monat wurde der Text angekündigt und im Juli-Heft ist er nun erschienen: „Plan B“.
Wie immer legt Brumlik seine jüdische Identität in die Waagschale, um jedweder Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen, und KONKRET scheint überglücklich zu sein, einen Vortrag, den der bundesweit bekannte und für seine Koscherstempel für Antisemiten unterschiedlicher Art (wie die Adorno-Preisträgerin Judith Butler, die zum Boykott Israels aufruft und Israel einen „Apartheidstaat“ nennt) bekannte Mann bereits in der Evangelischen Akademie Arnoldshain halten durfte, zu drucken.
Brumlik stellt einige aktuelle Bücher und Ansätze bezüglich Israel und den Arabern/Palästinensern vor, was jedoch nur Mittel zum Zweck ist: er möchte eine Idee von Martin Buber aus dem Jahr 1947 in die heutige Zeit retten und Israels jüdischen Charakter zerstören, um einen „binationalen“ Staat zu schaffen. Ein Kernpunkt Brumliks ist die ungeheuerliche, unfassbar antijüdische Idee, Juden das Rückkehrrecht nach Israel zu verweigern! O-Ton KONKRET:
„Einwanderung in den neuen Staat [Israel/Palästina] hingegen sollte das nationale Parlament nur nach arbeitsmarktspezifischen beziehungsweise humanitären Gesichtspunkten regeln, nicht mehr nach ethnischen Kriterien.“
Dieser harmlos daher kommende Satz ist vielleicht aggressiver und wirkungsmächtiger als alle Propaganda von NPD, der Linkspartei, den Grünen, der SPD, autonomen Neonazis, deutschen ‚Friedensgruppen‘, der jungen Welt und Ulrike Putz vom Spiegel und tausenden anderen Korrespondenten, Autorinnen, Gruppierungen und Hetzseiten im Internet in den letzten Jahren. Mit der vorgeblichen Nüchternheit eines 1947 in der Schweiz geborenen Pädagogen wird hier lachend Juden das unbedingte Recht auf Zuflucht verweigert. Evangelische Akademien wie auch KONKRET jubilieren zumal deshalb, da dieser Vorschlag von einem Juden kommt: besser kann eine tödliche Obsession gar nicht verpackt sein.
Antisemitismus ist eine „lethal Obsession“, so der Titel eines so umfangreichen wie beeindruckenden Buches des israelischen Historikers Robert S. Wistrich von 2010. Diese tödliche Obsession zeigt sich im Diffamieren des jüdischen Charakters Israels, während Brumlik nicht ein einziges Buch und nicht eine einzige Kampagne gegen den äußerst ethnisch homogenen Charakter Marokkos oder Saudi-Arabiens verfasst hat.
Doch das Problem ist grundsätzlicher Art. Wie der israelische Historiker Yoram Hazony in seinem Buch „The Jewish State“ im Jahr 2000 zeigt, waren es gerade deutsche Juden wie Martin Buber, Hannah Arendt und dutzende andere, die in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren Israel als binationalen Staat konzipiert wissen wollten und schon damals die Aggressionen vieler Araber und Muslime schlicht ignorierten (Stichwort: Massaker von Hebron 1929, um nur ein Beispiel zu nennen).
Hazony hat seinen Ansatz in zwei Texten im Jahr 2010 verdeutlicht: demnach geht es bei der Kritik des Antizionismus keineswegs nur um inakkurate, uninformierte oder bloß lästerliche Berichterstattung bezüglich Israel. Nein. Es geht um einen „Paradigmenwechsel“, so Hazony. Die Europäer, die sich gerne als Herrenmenschen aufspielen, nach 1945 im großen Maßstab und mit der Verve, die Lehren aus dem Holocaust und dem SS-Staat gelernt zu haben, verweigern anscheinend dem Nationalstaat die Legitimation. Daher der supranationale Charakter der EU.
Blöd nur, dass Kroatien oder die Mini-Länder Estland, Lettland, Litauen und andere (wie Kosovo) gerade das Gegenteil beweisen: es gibt heute viel mehr Staaten in Europa als vor 1989/1991 (Ende der DDR/Ende der UdSSR). Gleichermaßen ist den Europäern bewusst, dass im Nahen Osten Staaten existieren, die niemals grundsätzlich in Frage gestellt werden (wie Marokko oder Saudi-Arabien, der Iran etc. etc.).
Für Hazony liegt das in der Philosophie Immanuel Kants begründet. Demnach ist für Kant in dessen politischem Testament „Zum ewigen Frieden“ das Ende von stehenden Heeren und Staaten zwar Utopie, doch es gebe unterschiedliche Formen „moralischer Reife“. Von Muslimen oder Arabern könne man so eine Kantsche Politik der Überwindung von Staaten und Heeren nicht erwarten. Juden und Israel hingegen müssen sich an Kant (oder heute: Jürgen Habermas, Seyla Benhabib, Judith Butler/Micha Brumlik) orientieren, sie seien bereits „moralisch reif“, Muslime oder Araber noch im Stadium des „Kindes“, also „unreif“.
Für Hazony gibt es zwei Paradigmen nach 1945:
Paradigma A: Auschwitz bedeutet das unsagbare Entsetzen jüdischer Frauen und Männer, die nackt und mit leeren Händen dastehen und zusehen müssen, wie ihre Kinder sterben, weil es ihnen an einer Waffe fehlt, mit der sie sie beschützen könnten.
Paradigma B: Auschwitz bedeutet den unsagbaren Schrecken, den deutsche Soldaten verbreiten, die Gewalt gegen andere anwenden und von nichts anderem legitimiert werden als den Ansichten ihrer Regierung über ihre nationalen Rechte und Interessen.
Europa steht für Paradigma B. Der Nationalsozialismus wird als ein extremer Nationalstaat gesehen und gerade nicht als anti-Nationalstaat. Europa steht in deren Augen für diejenige Instanz, mit zärtlichsten Gefühlen und der ernsthaften Überzeugung für das Gute und Kantsche auf der Welt einzutreten. Das heißt jedoch konkret, dem Judenmord der fanatisierten arabischen Massen im Nahen Osten, zumal im „Westjordanland“ wo Straßen und Plätze nach suicide bombern benannt werden, Tür und Tor zu öffnen. Gleichzeitig wird Juden Tür und Tor Israels als immerwährendem Zufluchtsort vor Judenhass (wie in der Sowjetunion und ex-Sowjetunion, oder im heutigen Frankreich, in Schweden, Holland, Deutschland etc. etc.) verweigert.
Micha Brumlik, die Evangelische Akademie Arnoldshain und ihr Sprachrohr, die Monatszeitschrift „KONKRET. Organ für distinguierten Israelhass mit Koscherstempel“, schlagen sich auf die Seite Europas und gegen die Juden und Israel.
Man denke an Ignatz Bubis, der von genau diesem immerwährenden Rückkehrrecht von Juden nach Israel Gebrauch machte, als er, geschlagen vom elenden Antisemitismus der Deutschen und Martin Walser, sich in Israel beerdigen ließ. Nach der umwerfenden Logik von Micha Brumlik und seinen Helfershelfern hätte eine solche Bestattung eines Juden in Israel keinen arbeitsmarktpolitischen Sinn und wäre zu verweigern. Sollen die Neonazis doch Bubis‘ Grab beschmieren, aufs Ekligste beschädigen und den Grabstein zerstören, wie sie wollen.
Der nüchterne Ton von KONKRET und von Brumlik ist Strategie. Sie wollen nicht nur ein kleines Strohfeuer des Israelhasses, wie wir es aus unendlich vielen kleinen Skandalen von Süddeutscher Zeitung bis Jakob Augstein und Günter Grass kennen.
Sie wollen vielmehr eine langfristig angelegte Delegitimationskampagne gegen den jüdischen Staat Israel fahren und werden in Haftung zu nehmen sein, wenn Juden sich in Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich wieder dem rasenden Mob der Judenmörder ungeschützt ausgeliefert sehen, in Tel Aviv, Jerusalem, oder Eilat. Die IDF wird jeden Krieg gewinnen, es ist einfach eine viel zu gut ausgerüstete Armee.
Doch den Krieg der Ideen wird Israel weiter verlieren, solange Leute wie Micha Brumlik, Einrichtungen wie die Evangelische Akademie Arnoldshain oder die Zeitschrift KONKRET der lethal Obsession auch noch einen Koscherstempel geben.
*Der Autor, Dr. phil. Clemens Heni, ist Direktor des Berlin International Center for the Study of Antisemitism( BICSA), www.bicsa.org